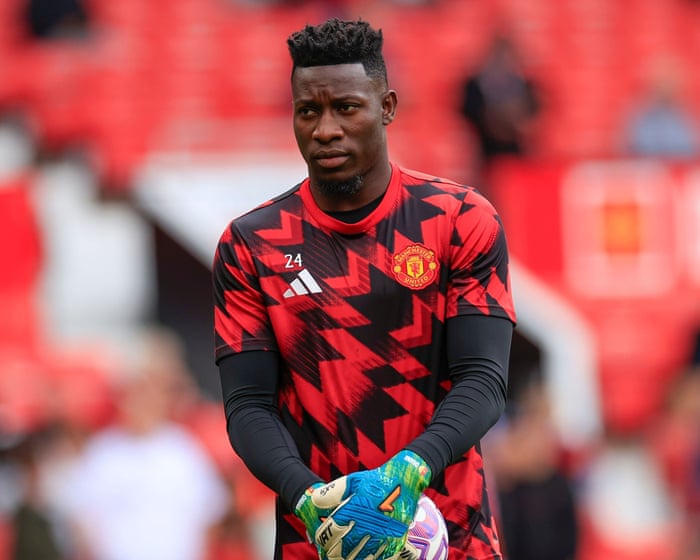Emmanuel Macron sprach mit der Stimme eines trauernden Mannes – nicht wütend oder trotzig, sondern einfach nur traurig. Er beklagte, dass Europa eine "Degeneration der Demokratie" erlebe. Der französische Präsident verwies auf externe Bedrohungen durch Russland, China sowie mächtige US-Techkonzerne und Social-Media-Unternehmer. "Aber wir sollten nicht naiv sein", fügte er hinzu. "Intern wenden wir uns gegen uns selbst. Wir zweifeln an unserer eigenen Demokratie... Überall geschieht etwas mit unserem demokratischen Gefüge. Die demokratische Debatte wird zu einer Hassdebatte."
Macron kennt diese Realität gut, gefangen zwischen den verhärteten Extremen von Rechts und Links. Doch Frankreich, oft als "unregierbar" bezeichnet, steht mit seinen tiefen Gräben nicht allein da. In ganz Europa, dem UK und den USA verschlimmern Misstrauen und Groll das politische Versagen und soziale Konflikte. Macrons Worte finden in fast jedem Land Widerhall, das demokratische Prinzipien hochhält. Der Glaube, dass Demokratie die beste Regierungsform für die moderne Welt sei, schwindet, besonders unter jungen Menschen, während der öffentliche Diskurs härter und gewalttätiger wird.
Macron äußerte diese Bemerkungen bei einer Veranstaltung zum 35. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung 1990 – einem Moment großer Hoffnung. Doch heute ist Deutschland, ähnlich wie Frankreich, tief gespalten und sieht sich einer Krise des politischen Glaubens gegenüber.
Blickt man um sich: Bei jüngsten Wahlen schloss sich Tschechien Polen, Österreich und anderen EU-Staaten an, die sich unter einer Welle anti-establishmentärer Stimmungen dem populistischen Rechtsextremismus zuwenden. Die Unterstützung für opportunistische Figuren, die Ängste und Ressentiments ausnutzen – während sie kaum glaubwürdige Politiken zu Themen wie Migration bieten – stärkt die Demokratie nicht, sondern untergräbt sie. Diese Hinwendung zu Extremen spiegelt einen Vertrauensverlust in das demokratische System selbst wider, verschärft durch sinkende Wahlbeteiligung marginalisierter Gruppen.
In vielen dieser Länder fehlt ein demokratischer Grundkonsens. In Großbritannien, wo Nationalflaggen wie Schmusedecken umklammert werden, kämpfen beide großen Parteien, und Alternativen erscheinen unrealistisch oder schädlich. In den USA, der sogenannten "Heimat der Demokratie", ist wirksamer Widerstand gegen die Ein-Parteien-Herrschaft der Republikaner auf nationaler Ebene weitgehend zusammengebrochen. Donald Trump ähnelt durch seinen Versuch, Wahlbezirke zu manipulieren, zunehmend einem Diktator.
Mangelnde demokratische Wahlmöglichkeiten und wirtschaftliche Perspektiven nähren Entfremdung und Unruhen in so unterschiedlichen Ländern wie Marokko, Kenia und Bangladesch, die alle jüngst Turbulenzen erlebten. Auf den Philippinen, in Nigeria, der Türkei, Indonesien und Madagaskar lösten Korruption und Machtmissbrauch regierungsfeindliche Proteste aus. In Nepal führten Jugendliche letzten Monat eine "Gen-Z-Revolution" an. Obwohl sich diese Nationen in vielem unterscheiden, teilen sie ein entscheidendes Merkmal: Verglichen mit autokratischen Regimen wie China und Russland sind ihre Gesellschaften – vorläufig – relativ offen und frei.
Die grundlegende Herausforderung ist, dass Demokratie nicht funktioniert oder so schlecht, dass sie Gefahr läuft, verworfen zu werden. Die einst vorbildlichen USA haben sich verirrt, und Westeuropa ist gespalten und schwankend. Unterdessen stehen neue Demokratien im Globalen Süden sowie Mittel- und Osteuropa an vorderster Front eines neuen Kalten Krieges um Einfluss und Werte gegen die Achse Peking-Moskau. Wie Moldau und Georgien – zwei jüngste Schlachtfelder – bleibt ihre künftige Richtung ungewiss.
Eine Krise bahnt sich an. Laut dem Jahresbericht von Freedom House waren bei über 40 % der nationalen Wahlen 2024 Gewalt, Wahlmanipulation und Unterdrückung zu verzeichnen. Die globale Freiheit, gemessen an politischen Freiheiten und Bürgerrechten, nahm zum 19. Mal in Folge ab. Der Bericht kam zu dem Schluss: "Konflikte verbreiten Instabilität und behinderten demokratische Fortschritte weltweit."
In den USA ergab eine aktuelle Umfrage, dass rekordhafte 64 % der Amerikaner glauben... Viele Menschen glauben, ihre Demokratie sei politisch zu zersplittert, um die Probleme des Landes zu lösen. In Großbritannien waren in einer Umfrage unter 16- bis 29-Jährigen 63 % der Meinung, die Demokratie sei in Gefahr. Zwar ziehen 57 % der Jugendlichen eine Demokratie einer Diktatur vor (gegenüber 27 %, die das nicht tun), aber nur 35 % würden sich in organisierter Politik engagieren.
In Spanien ist das einst Unvorstellbare heute normal: Junge Menschen wenden sich der extremen Rechten zu.
Wenn es einen globalen Aufstand gegen die Demokratie gibt oder zumindest einen erheblichen Vertrauensverlust in demokratische Systeme, wäre es hilfreich, die Gründe zu verstehen. Dazu zählen kurzfristige und langfristige wirtschaftliche Probleme wie Lebenshaltungskosten, Inflation, Mangel an guten Jobs, Deindustrialisierung, zerrüttete Gemeinschaften, institutionelles Versagen, Wohlstandsungleichheit, Globalisierung und klimabedingte Massenmigration. Der Mythos vom endlosen nachhaltigen Wachstum ist ebenfalls zerplatzt. Weitere Gründe sind unzuverlässige Führungspersönlichkeiten, sinkende moralische Standards, Wahlbeeinflussung und online verbreitete Desinformation durch Russland und andere. Jüngere Generationen fühlen sich gegen ältere Bevölkerungsgruppen in Stellung gebracht, und es herrscht weit verbreitete Hoffnungslosigkeit und Wut über das ökologische und geopolitische Chaos der Welt.
Laut Andreas Reckwitz von der Berliner Humboldt-Universität entspringt diese Unzufriedenheit einem tiefen und weit verbreiteten Gefühl des Verlusts. Er argumentiert, dass der Kern glaube der westlichen Moderne – dass menschlicher Fortschritt konstant und unvermeidlich sei und das Leben sich stets verbessere – durch die letzten Jahrzehnte erschüttert wurde. Verlust ist zur gemeinsamen Erfahrung geworden, und die Herausforderung liegt darin, ob Gesellschaften, die auf "besser" oder "mehr" fokussiert sind, lernen können, mit "weniger" und "schlechter" umzugehen.
Aus dieser Perspektive werden die Ablehnung versagender demokratischer Systeme und der Aufstieg populistischer Führer, die eine Rückkehr in die Vergangenheit versprechen, verständlicher. Reckwitz warnt, dass Politik, die weiterhin unendliche Verbesserung verspricht, Enttäuschung schürt und den Populismus stärkt, der von gebrochenen Versprechen lebt und nur Illusionen der Wiederherstellung bietet. Die Schlüsselfrage ist daher, wie mit Verlust umzugehen ist.
Reckwitz hat eigene Ideen und betont Resilienz und Umverteilung. Falls jemand eine klare Lösung hat, wären Führungspersönlichkeiten wie Macron, die viel zu verlieren haben, sicher begierig, sie zu hören.
Simon Tisdall ist Kommentator für internationale Angelegenheiten beim Guardian.
Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs zum global schwindenden Glauben an die Demokratie, inspiriert vom Thema, mit klaren und präzisen Antworten.
Allgemeine / Einsteigerfragen
1. Was bedeutet "schwindender Glaube an die Demokratie" eigentlich?
Es bedeutet, dass weltweit immer mehr Menschen desillusioniert von demokratischen Systemen sind. Sie haben das Gefühl, dass die Demokratie ihre Versprechen nicht hält, korrupt ist oder zu langsam ist, um große Probleme zu lösen.
2. Ist das wirklich ein globales Problem oder betrifft es nur einige Länder?
Es ist ein weitverbreiteter globaler Trend. Während Länder wie Frankreich, die USA und Brasilien oft Schlagzeilen machen, zeigen Studien eine sinkende Zufriedenheit mit der Demokratie in vielen etablierten und neuen Demokratien in Europa, Lateinamerika und Asien.
3. Was sind die Hauptgründe, warum Menschen das Vertrauen in die Demokratie verlieren?
Häufige Gründe sind:
- Wirtschaftliche Ungleichheit: Das Gefühl, dass das System nur den Reichen und Mächtigen nützt.
- Politische Polarisierung: Extreme Spaltung führt dazu, dass Regierungen nicht effektiv handeln können.
- Desinformation: Die Verbreitung falscher Informationen online untergräbt gemeinsame Fakten und Vertrauen.
- Wahrgenommene Korruption: Der Glaube, dass Politiker selbstsüchtig handeln und nicht für das Volk arbeiten.
4. Zu welcher Alternative zur Demokratie wenden sich die Menschen?
Einige Menschen sind offener für nicht-demokratische Alternativen wie die Herrschaft eines starken Mannes oder Technokratie, in der Überzeugung, dass diese mehr Stabilität und Effizienz bieten können.
Tiefgehende / Fortgeschrittene Fragen
5. Wie trägt soziale Medien zu dieser Krise bei?
Algorithmen sozialer Medien fördern oft spaltende und emotional aufgeladene Inhalte, um Nutzer zu binden. Dies vertieft die politische Polarisierung, verbreitet Fehlinformationen schnell und macht konstruktive, faktenbasierte Debatten fast unmöglich.
6. Sind junge Menschen eher desillusioniert von der Demokratie?
Umfragen zeigen oft, dass jüngere Generationen, die in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und politischer Blockaden aufgewachsen sind, eher Unzufriedenheit mit der Demokratie äußern und ihr weniger als einzige Regierungsform verbunden sind als ältere Generationen.
7. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen wirtschaftlichen Problemen und dem Niedergang der Demokratie?
Wenn Menschen finanziell kämpfen und eine wachsende Wohlstandslücke sehen, verlieren sie oft das Vertrauen in das System, das sie im Stich gelassen hat. Diese wirtschaftliche Angst macht sie anfälliger dafür, populistische Führer zu unterstützen.