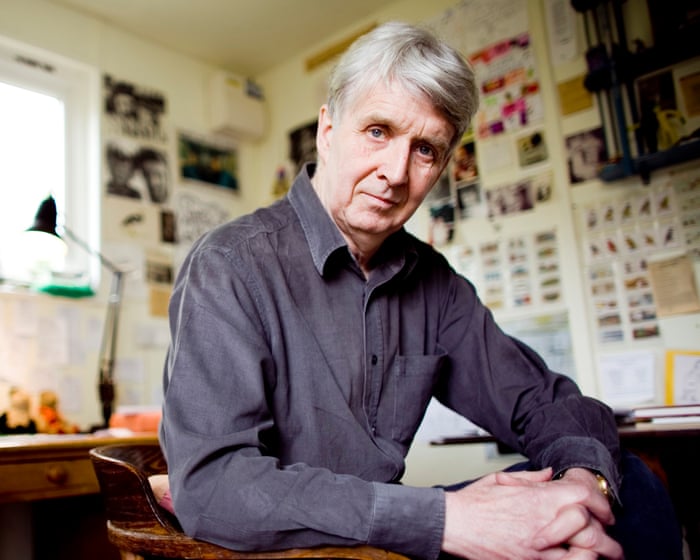Eine neue Kunstausstellung widmet sich den Hochhaus-Plattenbauten des kommunistischen Ostdeutschlands und deren politischer sowie kultureller Wirkung – und beleuchtet damit eines der größten sozialen Wohnungsexperimente der Geschichte. Die Schau reflektiert zugleich subtil die unausgesprochenen Herausforderungen der heutigen Wohnungskrise.
Unter dem Titel Wohnkomplex: Kunst und Leben in der Platte erkundet die Ausstellung die kollektive Erfahrung von Millionen Ostdeutschen. Sie erinnert eindrücklich daran, dass die "Wohnungsfrage" – ob unter Diktatur oder Demokratie – noch lange nicht gelöst ist.
Mit 50 Werken von 22 Künstlern, von denen die meisten in oder nahe eines Plattenbaus (benannt nach den Betonfertigteilen der Konstruktion) lebten, untersucht die Ausstellung, wie diese großflächigen, standardisierten Siedlungen das Leben der Bewohner und damit die Gesellschaft als Ganzes prägten. Der Bau dieser Gebäude war zentral für die Sozialpolitik der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) und stützte zugleich deren industrielle Identität.
"Es geht um die Platte als Ort und Erinnerung des Wohnens, als Symbol sozialer Utopien und als Leinwand für gesellschaftlichen Wandel", sagt Kito Nedo, Kurator der Ausstellung in Potsdams Minsk-Kunsthalle – einem wichtigen architektonischen Beispiel des Ostmodern, das beinahe abgerissen worden wäre, bevor Proteste es retteten.
"Die drängendste Frage, in Deutschland und Städten europaweit relevanter denn je, ist: Wie schafft man bezahlbaren, qualitativ hochwertigen Wohnraum?", ergänzt Nedo. "Der DDR-Wohnungsbau war ein historischer Versuch, diese zu beantworten. Eine Herausforderung, der sich Politiker noch heute stellen."
Ab den 1970er Jahren, als die Massenproduktion begann, galt eine Wohnung in diesen standardisierten Betonkomplexen für viele Ostdeutsche als Traumheim. Zogen sie doch die Verheißung moderner Komforts mit sich: Innentoilette, offene Küche mit Essecke und Durchreiche, verlässliche Fernwärme sowie Annehmlichkeiten wie öffentlicher Nahverkehr, Kaufhallen, Kinderbetreuung, Schulen, Jugendclubs und Gesundheitszentren. Auch Grünflächen zur Erholung waren Teil des Plans, auch wenn diese mitunter länger auf sich warten ließen.
Die Geschwindigkeit des Bauens hält Sonya Schönberger in archäologisch anmutenden Skulpturen fest, die in Silikon Schuh- und Tatzenabdrücke von Bewohnern auf noch feuchten Betonplatten im Berliner Ostseeviertel (erbaut 1984–1988) konservieren.
Das Design dieser Wohnsiedlungen – mit Kinderbetreuung, Arbeitsplatznähe und anderen Merkmalen – galt als progressiv und sollte, wie in der DDR-Verfassung festgehalten, die Gleichberechtigung der Geschlechter unterstützen. Dennoch, wie Kurt Dornis’ Gemälde Zweite Schicht zeigt, das eine Frau durch eine Küchendurchreiche blicken lässt, lasteten nach der Arbeit viele Pflichten weiterhin auf den Frauen.
Die Standardisierung griff auf den Alltag über und wurde damals zum Gegenstand von Witzen. Elektriker fanden Steckdosen angeblich blind, und man scherzte, man müsse bei Besuchen nie nach der Toilette fragen.
"Ostdeutsche witzelten, bei Fremden nie nach dem Klo fragen zu müssen", so Nedo, der nahe einem der größten DDR-Komplexe in Leipzig aufwuchs.
Autorin und Regisseurin Grit Lemke erinnert sich an den starken Gemeinschaftssinn in Hoyerswerda, einer designierten sozialistischen Modellstadt, wo sie in einem Hochhauskomplex aufwuchs: "Alle kannten alle… wir Kinder spielten Plattenhasche… ich hatte in jeder Wanne gebadet… eine Kindheit in einer großen, wilden und freien Kollektivität."
Während diese Bauten von vielen geschätzt wurden… zogen Plattenbauten aufgrund mangelnden Komforts und Individualität abfällige Spitznamen wie "Arbeiterschließfächer" auf sich. Der Schriftsteller Heiner Müller, der eine 166-Quadratmeter-Wohnung im 14. Stock eines Hauses in Berlin-Lichtenberg bewohnte, nannte sie spöttisch "Fickzellen mit Fernwärme". Brigitte Reimann, deren kritische Sicht auf ostdeutsches Wohnen zentral für ihren 1974 erschienenen Roman Franziska Linkerhand ist – über eine Architektin, deren Vision einer Zukunftsstadt an starren ideologischen Bauvorschriften scheitert –, beschrieb diese Bauten als "gesichtslos und austauschbar" und verglich sie mit "einem Stockwerk aus Dutzenden Zellen, die nebeneinander und übereinander gestapelt sind".
Die Ausstellung hält diese und andere Blickwinkel in Gemälden, Fotografien, Skulpturen sowie einem Programm aus Lesungen, Filmen und Stadtspaziergängen fest. Eine Sammlung schwarz-weißer Fotografien von Sibylle Bergemann zeigt, wie Bewohner die uniformen, rasterartigen Grundrisse ihrer Heime mit Tapeten, Lampen und Stofftieren zu individualisieren versuchten.
Es entstand eine Kultur des Balkonschmucks, bei der Bewohner ihre Balkons mit Markisen, antiken Wagenrädern, fliesenimitierendem Linoleum und Blumenkästen aufwerteten. Der Architektursoziologe Bruno Flierl bemerkte damals, dieser Trend stelle eine Form "antiautoritärer Selbsthilfe" und "subjektiver Architekturkritik" dar, und bewunderte die "Fantasie und den Mut" der Bewohner.
Obwohl anfangs stark nachgefragt, sank das Ansehen dieser Plattenbauten nach dem Mauerfall rapide, als sie zu Symbolen des sozialen Verfalls wurden. Viele wurden abgerissen, durch Entfernen ganzer Etagen verkleinert, saniert oder umgebaut.
Die Installationen Amnesia und Terror der Künstlerin Henrike Naumann thematisieren die Radikalisierung der rechtsterroristischen Gruppe NSU in Plattenbauwohnungen in Jena sowie rassistische Angriffe in Städten wie Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, als diese einst modernen Siedlungen zu Orten schwierigen Wandels wurden.
Städte wie Hoyerswerda schrumpften rapide, als Fabriken schlossen, Bewohner wegzogen und staatlich subventionierte Abrisse stattfanden.
"Endlich ergab sich die Chance, die Kluft zwischen Utopie und Realität zu überbrücken", sagt Lemke, "doch sie entglitt uns."
Nedo erläutert, dass es der Ausstellung nicht um Nostalgie gehe, sondern um die Anerkennung der fortwährenden Präsenz dieser Bauten. "Wenn wir über die DDR sprechen, endet die Geschichte oft 1990", bemerkt er. "Vieler ihrer repräsentativen Bauten wurde abgerissen, doch die Plattenbauten blieben, samt der kollektiven Erfahrung des Darinlebens. Sie sind noch immer Teil der Gegenwart, auch wenn dies kaum jemand wahrhaben will."
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Zum Erbe der DDR-Plattenbauten
Einsteigerfragen
1. Was waren die Plattenbauten der DDR?
Es handelte sich um in Massenproduktion gefertigte Wohnblocks, bekannt als Plattenbauten, aus vorgefertigten Betonplatten. Sie wurden schnell und kostengünstig errichtet, um Wohnungsengpässe in der DDR zu beheben.
2. Warum sind diese Gebäude heute noch relevant?
Sie bieten Lehren für bezahlbaren, effizienten Stadtwohnungsbau und Nachhaltigkeit – Themen, die mit dem Wachstum der Städte und steigenden Wohnkosten immer wichtiger werden.
3. Gab es diese Bauten nur in der DDR?
Nein, ähnlicher Plattenbau wurde im gesamten Ostblock und in anderen Teilen der Welt genutzt, aber die DDR-Variante ist besonders bekannt.
4. Stehen diese Gebäude noch?
Ja, viele wurden saniert und werden noch bewohnt, besonders in Städten wie Berlin und Leipzig.
Vorteile & moderne Relevanz
5. Warum ist Plattenbau eine gute Lösung für heutige Städte?
Er ist kosteneffizient, schnell zu errichten und kann energieeffizient gestaltet werden – ideal für bezahlbaren Wohnraum in wachsenden urbanen Gebieten.
6. Wie können alte Plattenbauten nachhaltig gemacht werden?
Durch Modernisierungen wie bessere Dämmung, Solaranlagen, Gründächer und effiziente Heizsysteme, die Energieverbrauch und CO₂-Fußabdruck reduzieren.
7. Fördern diese Gebäude gemeinschaftliches Leben?
Ja, viele waren mit gemeinsamen Grünflächen, Spielplätzen und lokalen Einrichtungen geplant, die Gemeinschaftssinn förderten – etwas, das moderne Stadtplaner schätzen.
Häufige Probleme & Kritik
8. Waren diese Gebäude nicht schlecht gebaut und hässlich?
Einige wurden für einfaches Design und minderwertige Materialien kritisiert, aber viele wurden modernisiert und mit besserer Ästhetik und Funktionalität neu gestaltet.
9. Was waren die größten Probleme der originalen Plattenbauten?
Schlechte Isolierung, eintönige Architektur und teilweise soziale Stigmatisierung. Sanierungen haben jedoch viele dieser Probleme behoben.
10. Werden diese Gebäude mit negativen historischen Erinnerungen verbunden?
Für manche symbolisieren sie die autoritäre Vergangenheit der DDR, heute werden sie aber auch als praktischer Wohnraum mit kulturellem und architektonischem Wert gesehen.
Beispiele & praktische Anwendungen
11. Wo kann man Beispiele sanierter Plattenbauten sehen?
In Berliner Vierteln wie Marzahn und Hellersdorf.