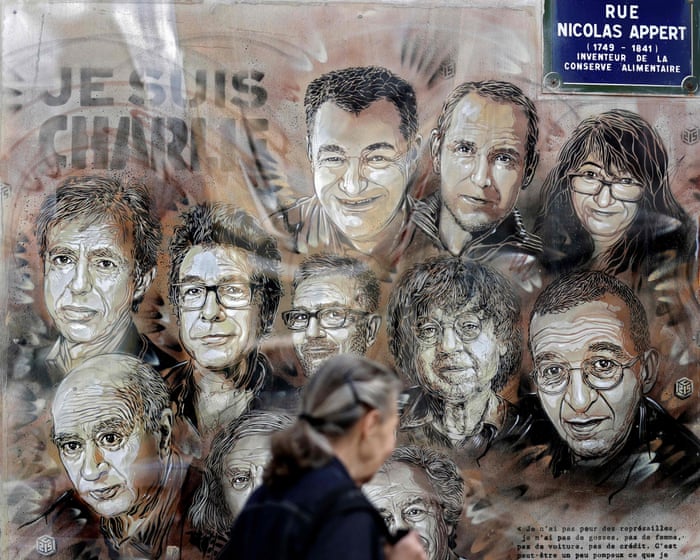Hier ist die Übersetzung des Textes ins Deutsche:
---
"Es fühlte sich erschreckend an... wie in einer brennenden Stadt während eines nächtlichen Angriffs gefangen zu sein." Dr. Arwyn Edwards beschreibt hier keinen Krieg, sondern einen heißen, nebligen Tag auf einem Gletscher in Svalbard, wo rekordverdächtige Sommerhitze seinen Forschungsstandort in einen reißenden Schmelzwasserstrom und stürzende Felsen verwandelte.
Edwards ist Spezialist für Gletscherökologie – er erforscht Leben, das auf, in und um Gletscher und Eisschilde existiert. Nach zwanzig Jahren Polarforschung fühlte er sich auf dem Eis immer „ruhig und entspannt“. Doch der rasche Klimawandel nagt an diesem Sicherheitsgefühl.
Während die globalen Temperaturen die 1,5°C-Grenze des Pariser Abkommens noch nicht überschritten haben, wurde dieser Schwellenwert in der Arktis bereits vor langer Zeit überschritten. Svalbard erwärmt sich siebenmal schneller als der globale Durchschnitt.
Die Zeit läuft davon, um diese fragilen Ökosysteme zu verstehen – und die Billionen an klimabedingten Kosten, die sie auslösen könnten.
Edwards nennt die kälteliebenden Mikroben, die er erforscht, „die Wächter und Verursacher des Niedergangs der Arktis“. Aktuelle Studien zeigen, dass schnee- und eisbewohnende Mikroben Rückkopplungseffekte erzeugen können, die das Schmelzen beschleunigen. Da über 70 % des Süßwassers der Erde in Eis und Schnee gebunden sind – und Milliarden Menschen von gletschergespeisten Flüssen abhängen – hat dies weltweite Folgen.
Doch nicht alle polaren Mikroben verschlimmern die globale Erwärmung. Einige könnten sogar Methanemissionen verlangsamen – zumindest vorerst.
### Gefrorene Regenwälder
Bis vor kurzem glaubten Wissenschaftler, dass arktisches Eis und Schnee weitgehend lebenslos seien. Auf Longyearbreen, einem Gletscher in der Nähe der nördlichsten Stadt der Welt, gräbt Edwards durch den Schnee des letzten Winters, um zu erklären, warum diese Annahme falsch war.
Jede frische Schneedecke trägt Mikroben mit sich, und erstaunlicherweise können Mikroben sogar die Bildung von Schneeflocken auslösen. Jeder Kubikzentimeter Gletscherschnee enthält Hunderte bis Tausende lebender Zellen – und typischerweise viermal so viele Viren – was ihn so komplex wie fruchtbaren Boden macht. „Die Organismen, die hier überleben, sind unglaublich hochentwickelt“, sagt Edwards.
Im Sommer gedeihen rot pigmentierte Algen auf den Schneeoberflächen, schwimmen auf und ab, um Sonnenlicht für die Photosynthese einzufangen und gleichzeitig UV-Schäden zu vermeiden. Starke Algenblüten erzeugen „Wassermelonenschnee“ oder „Blutschnee“, ein Phänomen, das bereits von Aristoteles beschrieben wurde.
Unter dem Schnee trifft Edwards' Schaufel auf festes Gletschereis – einen weiteren lebendigen Lebensraum, in dem Mikroben extreme Kälte, knappe Nährstoffe und den ständigen Wechsel zwischen arktischer Winterdunkelheit und sommerlichem Dauerlicht überleben. „Wenn ich einen Gletscher betrachte, sehe ich nicht nur Eis. Ich sehe... einen dreidimensionalen Bioreaktor“, sagt er.
Eingebettet ins Eis sind dunkle, erdähnliche Fragmente. Obwohl unscheinbar, werden diese „Kryokonit-Granula“ oft als „gefrorene Regenwälder“ der Gletscher bezeichnet. Jedes Granulat ist ein winziges, sich selbst erhaltendes Ökosystem, das von Bakterien, Pilzen, Viren, Protisten und sogar kleinen Tieren wie Bärtierchen und Würmern wimmelt.
Diese mikrobiellen Gemeinschaften können globale Prozesse beeinflussen, doch Edwards ärgert sich, dass viele Glaziologen sie als bloße „Verunreinigungen“ abtun. „Ozeanographen würden Fische im Meer nicht als Verunreinigungen behandeln“, merkt er an.
Mikroben in Oberflächeneis und Schnee produzieren dunkle Pigmente, um Sonnenlicht zu absorbieren und sich vor UV-Strahlen zu schützen. Sie fangen auch Staub und Trümmer ein, verdunkeln das Eis und den Schnee – was durch die Aufnahme von mehr Wärme das Schmelzen beschleunigt.
---
Mikroben auf dem Eis absorbieren mehr Wärme, was zu schnellerem Schmelzen führt – ein Phänomen, das als „biologische Verdunkelung“ bezeichnet wird. Diese Mikroben reagieren auch auf globale Veränderungen, wie erhöhte Nährstoffe durch Luftverschmutzung, Waldbrandrauch oder Staub von schrumpfenden Gletschern und sich ausdehnenden Trockengebieten. „Die Schneechemie heute unterscheidet sich von der vorindustriellen Zeit“, sagt Edwards. Steigende Temperaturen und längere Schmelzperioden, verursacht durch die globale Erwärmung, beschleunigen das Wachstum dieser eisverdunkelnden Mikroben weiter.
Zusammen erzeugen diese Faktoren einen gefährlichen Kreislauf: Mikroben verdunkeln das Eis, erhöhen die Temperaturen und beschleunigen das Schmelzen, wodurch mehr nährstoffreiches Geröll freigelegt wird. Dieses Geröll fördert noch mehr mikrobielles Wachstum, was die Oberfläche weiter verdunkelt.
Jeden Sommer bildet sich auf Grönlands südwestlichem Eisschild eine biologisch verdunkelte Zone – vom Weltall aus sichtbar und mindestens 100.000 Quadratkilometer groß. Eine Studie aus dem Jahr 2020 ergab, dass Mikroben dort zu 4,4 bis 6,0 Gigatonnen Schmelzwasserabfluss beitragen, was bis zu 13 % des gesamten Eisverlusts ausmacht. Grönlands Eis enthält genug Wasser, um den globalen Meeresspiegel um über 7 Meter anzuheben. Während IPCC-Berichte diese Effekte anerkennen, sind sie noch nicht in Klimamodelle einbezogen.
Gletscherschmelzwasser ist für Trinkwasser, Landwirtschaft und Wasserkraft für über 2 Milliarden Menschen in den europäischen Alpen, dem Himalaya und Zentralasien entscheidend. Doch selbst wenn die globale Erwärmung auf die Ziele des Pariser Abkommens begrenzt wird, wird die Hälfte dieser Gletscher bis zum Ende des Jahrhunderts verschwunden sein.
### **Methan: Eine verborgene Gefahr**
Neben der Eisverdunkelung lauert eine weitere Gefahr: Methan. In der Arktis speichern Gletscher und Permafrost riesige unterirdische Reserven dieses starken Treibhausgases. Doch neuere Studien zeigen, dass Mikroben unter Gletschern ebenfalls große Mengen Methan produzieren können. Während der Permafrost taut und Gletscher zurückweichen, werden unerwartete Methanfreisetzungen aus der Tiefe zu einem wachsenden Risiko.
Auf der anderen Seite des Fjords von Longyearbyen untersucht Professor Andy Hodson „Pingos“ – Hügel, die entstehen, wenn unter Druck stehendes Grundwasser durch gefrorenen Boden bricht. Das Wasser, das aus diesen Formationen austritt, ist mit Methan gesättigt. Hodson vergleicht den Effekt mit Gletschern, die „die Landschaft aufbrechen und Gas herauspressen. Methan sickert überall dort aus dem Boden, wo Flüssigkeiten unter dem Permafrost entweichen.“
Wie auf Kommando bricht plötzlich eine Methanblase an der Oberfläche eines Pingo-Sees auf. „Ich sage nicht, dass hier eine 50-Petagramm-Methanbombe kurz vor der Explosion steht“, sagt Hodson. Doch mit arktischen Rückkopplungseffekten, die die Klimakosten um 25–70 Billionen Dollar erhöhen könnten, sind die Risiken enorm.
Ein Grund, warum Hodson an diesem Ort nicht übermäßig beunruhigt ist, ist seine Entdeckung von methanfressenden Mikroben – Methanotrophen –, die im Pingo leben. „Diese Mikroben retten den Tag“, sagt er. Während sie nicht überall die Emissionen stoppen können, würde ohne sie weit mehr Methan entweichen.
### **„Ein sterbender Gletscher“**
Auf der Oberfläche von Fox...
(Anmerkung: Der Originaltext bricht mitten im Satz ab, daher wurde diese Struktur beibehalten.)
---
Auf Fonna, einem Gletscher in Zentral-Svalbard, stellt Edwards fest, dass die Eisoberfläche seit dem letzten Sommer um 4 Meter gesunken ist und seit seinem ersten Besuch im Jahr 2011 deutlich geschrumpft ist. „Dieser Gletscher ist todkrank“, sagt er. „Er befindet sich in der Palliativpflege, und doch scheint es niemanden zu interessieren.“
Wie alle lebenden Organismen beherbergt jeder Gletscher sein eigenes, einzigartiges Mikrobiom, das manchmal Arten enthält, die nirgendwo sonst vorkommen. Während Edwards erfolglos nach einem mikrobiellen Lebensraum sucht, den er im letzten Jahr untersuchte – wahrscheinlich durch Schmelzen und Erosion verloren –, vergleicht er seine Erfahrung mit Korallenriffbiologen, die ihre Forschungsstandorte ausbleichen und sterben sehen. Diese bedrohten Schnee- und eisbewohnenden Mikroben sind nicht nur wissenschaftlich wertvoll; sie könnten auch enormes wirtschaftliches Potenzial bergen. Ihre genetischen Anpassungen an extreme Kälte, Dunkelheit und Nährstoffmangel bieten eine Schatzkiste biotechnologischer Lösungen für Medizin, Industrie und Abfallmanagement. Doch mit steigenden globalen Temperaturen verlieren wir schnell die Chance, diese einzigartige biologische Vielfalt zu erforschen, zu nutzen und zu bewahren.
Edwards schlägt ein internationales Archiv vor, um polare Mikroben zu schützen – ähnlich dem Global Seed Vault in Svalbard, der Pflanzensorten in nahegelegenen Permafrostkammern lagert. „Wenn ich in Rente gehe oder sterbe, möchte ich, dass dieses mikrobielle Archiv als dauerhafte Ressource für zukünftige Generationen erhalten bleibt“, sagt er und deutet auf die weite, schwindende Landschaft. „Denn sie werden diesen Gletscher nicht haben, oder jenen, oder den dort drüben.“
Viele Besucher kommen nach Svalbard, um seine spektakuläre Tierwelt zu sehen, die – zumindest vorerst – noch reichlich vorhanden ist. Während einer Bootstour durch einen zentralen Fjord sichten wir über 80 Belugawale. Doch selbst diese lebhafte Gruppe ist auf unsichtbare Mikroben angewiesen: Die Wale fressen Fische, die sich von Plankton ernähren, das wiederum von marinen Mikroben abhängt, die durch Nährstoffe aus nahegelegenen Gletschern genährt werden – Lebensräume, die teilweise von den Mikroben geprägt werden, die Edwards erforscht.
Nordenskiöldbreen, ein Gletscher in Zentral-Svalbard. Foto: Ben Martynoga
Dies erinnert daran, dass polare Mikroben nicht nur Eisschmelze und globales Klima beeinflussen – sie erhalten ganze Ökosysteme. Ohne sie würde dieser Reichtum verschwinden.
Edwards vergleicht seine häufigen Arktisreisen mit Besuchen bei seinem Vater, der in einem Pflegeheim an vaskulärer Demenz litt. Jeder Besuch zeigte weiteren Verfall. „Es ist ein schleichender Prozess“, sagt er. „Man bemerkt den Verlust nicht Tag für Tag.“
### **FAQs zum Thema Arktische Gletscher und Mikroben**
#### **Einfache Fragen**
**1. Was passiert mit arktischen Gletschern?**
Arktische Gletscher schmelzen immer schneller, teilweise wegen Mikroben, die das Eis verdunkeln, wodurch es mehr Wärme aufnimmt und schneller schmilzt.
**2. Wie beschleunigen Mikroben das Gletscherschmelzen?**
Mikroben wie Algen wachsen auf dem Eis und machen es dunkler. Dunkleres Eis absorbiert mehr Sonnenlicht, was die Erwärmung und das Schmelzen verstärkt.
**3. Warum gilt dieser Rückgang als „irreversibel“?**
Sobald Gletscher einen bestimmten Punkt überschritten haben, können sie sich nicht mehr natürlich erholen, was zu dauerhaftem Eisverlust und steigenden Meeresspiegeln führt.
**4. Was sind die Hauptfolgen des arktischen Gletscherschwunds?**
Höhere Meeresspiegel, gestörte Ökosysteme und Veränderungen globaler Wetter