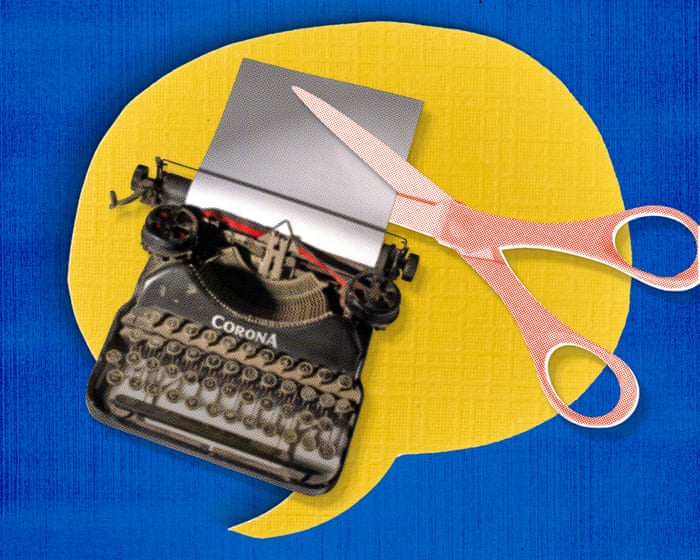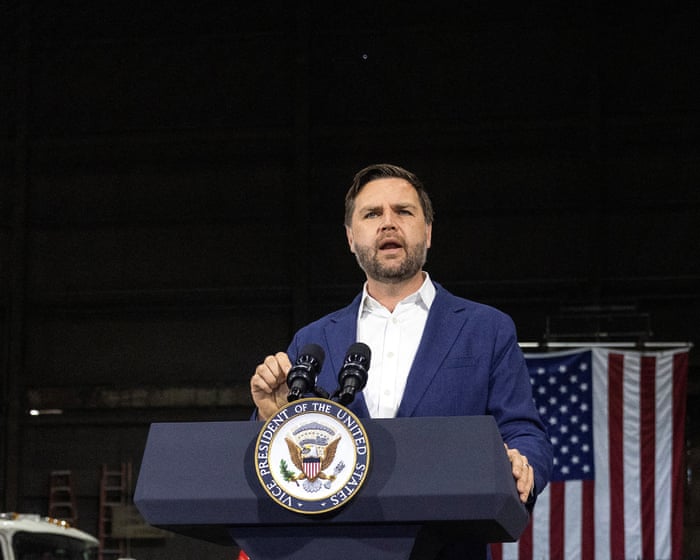Wird Brüssel jemals Donald Trump und die US-Tech-Giganten herausfordern? Das gegenwärtige Nichtstun ist mehr als ein rechtliches oder wirtschaftliches Versagen – es ist ein moralisches. Es stellt den Kern der europäischen demokratischen Identität in Frage. Es geht nicht nur um die Zukunft von Unternehmen wie Google oder Meta, sondern um das Prinzip, dass Europa das Recht hat, seinen digitalen Raum nach eigenen Gesetzen zu regulieren. Wenn die EU ihre eigenen Regeln nicht durchsetzen kann, riskiert sie, Washington und Silicon Valley untergeordnet zu sein, mit Trump als deren Herrn.
Um zu verstehen, wie wir an diesen Punkt gelangt sind, blicken wir zurück. Ende Juli willigte die Europäische Kommission in einen demütigenden Deal mit Trump ein und akzeptierte dauerhafte 15 % Zölle auf EU-Exporte in die USA, ohne etwas im Gegenzug zu erhalten. Verschlimmert wurde die Situation dadurch, dass die Kommission zusagte, über eine Billion Dollar in US-Energie- und Militäreinkäufe zu investieren. Dieses Abkommen offenbarte Europas fragile Abhängigkeit von den USA. Weniger als einen Monat später drohte Trump mit neuen, drastischen Zöllen, falls Europa auf seinem Hoheitsgebiet seine Gesetze gegen amerikanische Tech-Unternehmen durchsetze.
Jahrelang argumentierte Brüssel, sein Markt mit 450 Millionen kaufkräftigen Verbrauchern verleihe ihm unbestreitbare Verhandlungsmacht in Handelsgesprächen. Doch in den sechs Wochen seit Trumps Drohung hat Europa fast nichts unternommen. Es gab weder Vergeltungsmaßnahmen noch den Einsatz des neuen Anti-Zwangs-Instruments – der sogenannten "Handelsbazooka", die Europas ultimative Verteidigung gegen externen Druck sein sollte. Stattdessen gab es höfliche Stellungnahmen und eine Geldstrafe gegen Google, die weniger als 1 % seines Jahresumsatzes betrug, für langjährige wettbewerbswidrige Praktiken, die bereits von US-Gerichten festgestellt wurden und es ihm ermöglichten, seine dominante Stellung auf Europas Werbemarkt auszunutzen.
Unter Trumps Führung haben die USA ihre Ziele klar gemacht: Sie wollen nicht länger die europäische Demokratie unterstützen, sondern sie schwächen. Ein kürzlicher Essay auf dem Substack-Kanal des US-Außenministeriums, verfasst im gleichen alarmistischen und übertriebenen Ton wie Viktor Orbáns Reden, warf Europa vor, eine "aggressive Kampagne gegen die westliche Zivilisation selbst" zu führen. Er kritisierte angebliche Beschränkungen für autoritäre Parteien innerhalb der EU, wie Deutschlands AfD und Polens PiS.
Was also kann getan werden? Der europäische Anti-Zwangs-Mechanismus funktioniert, indem er das Ausmaß der Nötigung bewertet und Gegenmaßnahmen umsetzt. Wenn die meisten europäischen Regierungen zustimmen, könnte die Europäische Kommission US-Waren und Dienstleistungen vom europäischen Markt verbannen, Zölle verhängen, geistige Eigentumsrechte widerrufen, Investitionen blockieren oder Wiedergutmachung als Bedingung für die Rückkehr fordern.
Dieses Instrument dient nicht nur der wirtschaftlichen Vergeltung; es ist eine Aussage politischer Entschlossenheit. Es wurde geschaffen, um zu zeigen, dass Europa keine ausländische Nötigung akzeptieren würde. Doch jetzt, wo es am nötigsten ist, bleibt es ungenutzt. Es ist keine Bazooka; es ist ein Briefbeschwerer. Im Vorfeld des EU-US-Handelsabkommens sprachen viele europäische Regierungen öffentlich hart, drängten aber nicht auf die Aktivierung des Instruments. Andere, wie Irland und Italien, traten offen für einen nachsichtigeren Ansatz ein.
Eine weichere Haltung ist das Letzte, was Europa braucht. Es muss seine Gesetze durchsetzen, auch wenn es schwierig ist. Neben dem Einsatz des Anti-Zwangs-Instruments sollte Europa Social-Media-Algorithmen aussetzen, die unverlangte Inhalte empfehlen, bis deren Demokratieverträglichkeit nachgewiesen ist. Bürger, nicht von ausländischen Interessen kontrollierte Algorithmen, sollten die Freiheit haben zu wählen, was sie online sehen und teilen.
Trump übt Druck auf Europa aus, um seine digitalen Vorschriften aufzuweichen. Doch jetzt muss Europa mehr denn je große US-Tech-Firmen für wettbewerbswidriges Verhalten, das Ausspionieren von Europäern und die Ausbeutung von Kindern zur Verantwortung ziehen. Brüssel muss auch sicherstellen, dass Irland Europas Digitalregeln gegenüber US-Unternehmen durchsetzt. Allerdings reicht Durchsetzung allein nicht aus. Europa muss innerhalb der nächsten zehn Jahre schrittweise alle großen Tech-Plattformen und Cloud-Dienste von außerhalb der EU durch eigene Alternativen ersetzen.
Die eigentliche Gefahr in diesem Moment ist, dass Europa, wenn es jetzt nicht handelt, es vielleicht nie wieder tun wird. Je länger es zögert, desto mehr wird sein Selbstvertrauen schwinden. Es wird zunehmend glauben, dass Widerstand sinnlos ist, dass seine Gesetze nicht durchsetzbar sind, seine Institutionen keine Souveränität besitzen und seine Demokratie nicht wirklich selbstbestimmt ist. Sobald diese Denkweise Fuß fasst, wird der Abgleiten in den Autoritarismus unvermeidlich, angefacht durch algorithmische Manipulation in sozialen Medien und die Normalisierung von Falschinformationen. Wenn Europa weiter zurückweicht, wird es in denselben Abwärtsstrudel gezogen. Europa muss jetzt handeln, nicht nur, um sich Trump entgegenzustellen, sondern um einen Raum zu schaffen, in dem es als freie und souveräne Entität existieren kann.
Dabei muss Europa ein Beispiel setzen, an dem sich der Rest der Welt orientieren kann. Demokratien in Kanada, Südkorea und Japan beobachten genau. Sie fragen sich, ob die EU, die letzte Bastion des liberalen Multilateralismus, ausländischem Druck widerstehen oder ihm nachgeben wird. Sie fragen, ob demokratische Institutionen bestehen können, wenn die mächtigste Demokratie der Welt sie im Stich lässt. Sie sehen auch das Beispiel von Lula in Brasilien, der sich Trump entgegengestellt hat und zeigte, dass der Umgang mit einem Tyrannen darin besteht, entschlossen zurückzuschlagen.
Doch wenn Europa zögert, wenn es weiterhin höfliche Stellungnahmen abgibt, symbolische Geldstrafen verhängt und einfach auf eine bessere Zukunft hofft, hat es bereits verloren.
Johnny Ryan ist Direktor von Enforce, einer Einheit des Irish Council for Civil Liberties.
Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs zum Thema: Die EU besitzt eine versteckte Strategie, um Trumps wirtschaftliche Einschüchterung zu bekämpfen. Jetzt ist der Zeitpunkt, sie in die Tat umzusetzen, basierend auf der Perspektive von Johnny Ryan.
Anfängerfragen
1. Was ist diese versteckte Strategie der EU?
Die versteckte Strategie ist keine Geheimwaffe, sondern der etablierte, einheitliche Binnenmarkt der EU. Die Idee ist, dass die EU als großer Wirtschaftsblock durch ihr kollektives Gewicht Druck von größeren Ländern wie den USA widerstehen kann.
2. Was ist wirtschaftliche Einschüchterung?
Wirtschaftliche Einschüchterung liegt vor, wenn ein Land mit Zöllen, Sanktionen oder anderen Handelshemmnissen droht, um ein anderes Land zu zwingen, seine Politik zu ändern oder einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.
3. Warum wird diese Strategie als versteckt bezeichnet?
Sie wird als versteckt bezeichnet, weil der EU-Binnenmarkt eine alltägliche Realität und kein neues militärisches oder digitales Werkzeug ist. Seine Macht als defensive Wirtschaftswaffe wird oft übersehen, bis eine Krise wie ein Handelskrieg eintritt.
4. Was bedeutet "in die Tat umsetzen" konkret?
Es bedeutet, dass die EU ihre regulatorische und Marktmacht proaktiv nutzen sollte – beispielsweise durch das Setzen globaler Standards, das Verhängen eigener Zölle oder das Blockieren von Fusionen –, um ihre Interessen zu schützen und unfaire US-Handelspolitik zu kontern.
5. Wer ist Johnny Ryan?
Johnny Ryan ist Senior Fellow beim Irish Council for Civil Liberties und ein bekannter Experte für Digitalpolitik und die Macht großer Tech-Plattformen, der oft zu den Schnittstellen von Technologie, Regulierung und Geopolitik Stellung bezieht.
Fortgeschrittene / Strategische Fragen
6. Wie genau kann der EU-Binnenmarkt als Waffe eingesetzt werden?
Die EU kann ihren Markt mit 450 Millionen Verbrauchern nutzen, indem sie den Zugang davon abhängig macht. Sie kann beispielsweise ihre strengen Datenschutzvorschriften, Umweltstandards oder Wettbewerbsgesetze durchsetzen. Jedes Unternehmen, auch amerikanische, muss sich daran halten, um in der EU Geschäfte zu machen, was es der EU effektiv ermöglicht, globale Regeln zu setzen.
7. Welche konkreten Werkzeuge hat die EU, um US-Zöllen zu begegnen?
Die EU kann mit eigenen Ausgleichszöllen auf ikonische amerikanische Produkte reagieren, Fälle bei der Welthandelsorganisation einreichen oder ihre Kartellbehörde nutzen, um dominante US-Unternehmen zu untersuchen und zu bestrafen.