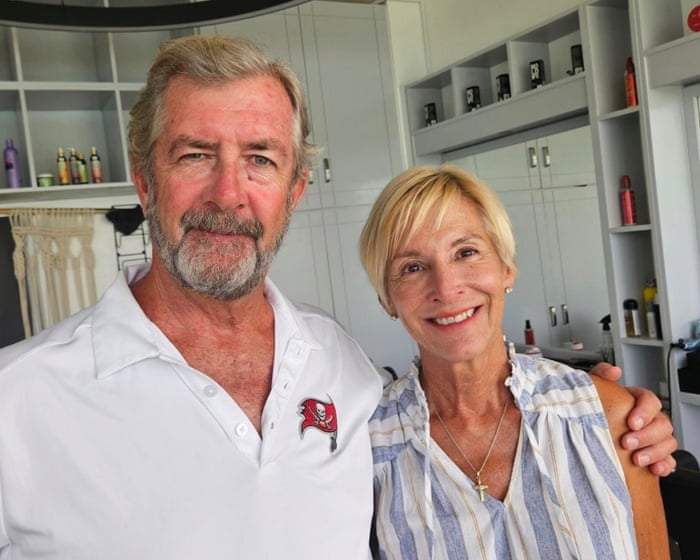Letzten Monat bei den UN bezeichnete Donald Trump die Klimakrise als "den größten Betrug, der jemals an der Welt verübt wurde". Mit diesen Worten lehnte der US-Präsident den überwältigenden wissenschaftlichen Konsens und alltägliche Beweise ab, die jeder mit einem einfachen Thermometer überprüfen kann. Er bestätigte zudem, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen austreten werden, das 2015 von 195 UN-Nationen unterzeichnet wurde. Damit reihen sich die USA in eine kleine Gruppe von Nicht-Ratifizierern ein, darunter Jemen, Iran und Libyen.
Ironischerweise könnte Trumps Kehrtwende eine Chance für andere eröffnen, die Klimaagenda voranzutreiben – indem ein neuer globaler Rahmen ohne die USA entworfen wird, obwohl Washington maßgeblich am alten mitgewirkt hat. Diese Neuordnung könnte beim nächsten UN-Klimagipfel COP30 in Brasilien Gestalt annehmen. Ihr Erfolg wird von der Führung eines ungewöhnlichen Duos abhängen: dem Gastgeberland, einem BRICS-Gründungsmitglied, und der EU, die weiterhin das politische Herz einer gespaltenen Westallianz bildet.
In Trumps Aussagen steckt oft ein Körnchen Wahrheit. Er liegt nicht ganz falsch, wenn er die UN als ineffektiv bezeichnet. Wie er in seiner Rede formulierte: "Alles, was sie zu tun scheinen, ist einen wirklich scharf formulierten Brief zu schreiben und ihn dann nie zu unterschreiben."
1995 eröffnete Angela Merkel, damals deutsche Umweltministerin, die erste COP in Berlin mit den Worten, die globale Erwärmung sei "die größte politische Herausforderung". Doch nach 30 COPs und drei Jahrzehnten deuten die Zahlen darauf hin, dass Jahre der Gespräche kaum mehr als heiße Luft produzierten. Die globalen CO₂-Emissionen lagen 1995 bei 23,5 Milliarden Tonnen; heute haben sie einen Rekordwert von 38 Milliarden Tonnen erreicht. Als Merkel erstmals versuchte, einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen auszuhandeln, machten diese 85 % des Gesamtenergieverbrauchs aus. Jetzt ist dieser Wert nur auf 80 % gesunken. Noch alarmierender: Während sich die Welt vor einem Jahrzehnt in Paris darauf einigte, den globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu halten, um die Kontrolle über die "Klimamaschine" nicht zu verlieren, hat Europa laut Copernicus-Observatorium bereits 2,4 °C erreicht.
Offensichtlich versagen wir. Der Multilateralismus steckt in der Krise – und das mag ein Grund sein, warum Populisten wie Trump an Attraktivität gewonnen haben. Doch der Rest der Welt hat nun womöglich eine letzte Chance zu beweisen, dass globale Probleme immer noch gemeinsam gelöst werden können. Trumps Entscheidung, die USA aus dem globalen Klimasystem zurückzuziehen, könnte das erhoffte Fenster sein – ähnlich der Chance, die EU-Länder 2020 ergriffen, als sie eine beispiellose Einigung zur Bewältigung der wirtschaftlichen Pandemieschäden erzielten. Ein Konsens über die Aufnahme gemeinsamer Schulden war nur möglich, weil Großbritannien, ein langjähriger Skeptiker, die EU verlassen hatte.
Was sollte also auf der nächsten COP ohne die USA getan werden? Einige der schwierigsten Themen – wie der "Loss and Damage"-Fonds zur Entschädigung armer Länder für Klimakatastrophen – drohen in kontroversen Verhandlungen unterzugehen. Andere Diskussionen, etwa zur Energiewende, werden durch Widerstand von Interessengruppen wie Landwirten, Hausbesitzern und europäischen Autoherstellern blockiert, die fürchten, am Ende die Zeche zu zahlen.
Das Ziel bleibt richtig, aber die Sprache, Messgrößen und Anreize müssen sich ändern. Vor allem muss klar sein, dass die Bewältigung der Klimakrise eine Innovationschance ist. Die Debatte darf sich nicht ewig darum drehen, wer zahlt und wer entschädigt wird. Letztlich geht es darum, in widerstandsfähigere Gesellschaften zu investieren, die weniger von einem instabilen und teuren Energiemodell abhängen.
Ebenso wichtig ist die Art und Weise, wie wir solche globalen Herausforderungen angehen. Die COPs etwa haben ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, das niemand als effizient bezeichnen kann. Der Begriff "nachhaltig" wirft die Frage auf: Müssen diese Konferenzen jährlich den Ort wechseln? Was, wenn sie dauerhaft an einem oder wenigen Schlüsselstandorten angesiedelt wären, die jeweils spezifische Herausforderungen bearbeiten?
Es könnte an der Zeit sein, die Mission der COP neu zu definieren. Derzeit verhandeln Diplomaten fieberhaft über den Wortlaut einer Abschlusserklärung, daneben gibt es zahlreiche Nebenveranstaltungen, die keine Entscheidungen beeinflussen. Stattdessen könnte sie sich darauf konzentrieren, Lösungen für Klimaprobleme zu finden, indem globale Best Practices genutzt werden, um politischen Entscheidungsträgern beizubringen, wie sie erfolgreiche Initiativen ausweiten können.
Zwei Schlüsselakteure sind für die nächste COP entscheidend. Brasilien als Gastgeberland muss einen Durchbruch erzielen. Die EU, anfällig für Handelskriege und nicht länger in der Lage, sich auf die USA zu verlassen, braucht dringend neue Verbündete.
Brasilien und die EU müssen sich um eine praktische Agenda vereinen. Sie sollten sich mit Indien, Kanada, Großbritannien, Australien (Gastgeber der COP31) und ja, China zusammentun. Diese sieben mögen in vielen kritischen Fragen uneins sein, doch sie stellen etwa die Hälfte der globalen Emissionen, Bevölkerung und des BIP. Wenn sie eine Einigung erzielen, werden wohl die meisten anderen Nationen folgen.
Die USA, beeinflusst von Trump und seinen MAGA-Anhängern, sind abwesend und werden es absehbar bleiben, obwohl sie denselben planetaren Krisen ausgesetzt sind – wie tödliche Waldbrände und Schneestürme – wie alle anderen. Dies ist ein schwerer Fehler, aber er bietet die Gelegenheit, eine Welt zu schaffen, die ohne eine dominante Supermacht effektiver funktioniert. Da die Klimadebatte stockt, müssen wir diese Chance nutzen.
Francesco Grillo ist Gastwissenschaftler am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und Direktor der Denkfabrik Vision.
Häufig gestellte Fragen
Natürlich, hier ist eine Liste von FAQs zum Thema, wie Trump die Klimawissenschaft als Betrug abtut und die ironische Vereinfachung, die dies laut Francesco Grillo bewirken könnte.
Allgemeine, einfache Fragen
1. Was bedeutet es, dass Trump die Klimawissenschaft als Betrug bezeichnete?
Es bedeutet, dass er öffentlich erklärte, er halte die Wissenschaft hinter dem menschengemachten Klimawandel für einen Schwindel oder Betrug, der darauf abziele, die amerikanische Industrie zu schädigen.
2. Wie kann das Leugnen eines Problems wie dem Klimawandel die Bemühungen zu seiner Bewältigung vereinfachen?
Wenn ein Führer die Wissenschaft vollständig ablehnt, schafft das für andere eine klare binäre Wahl: Entweder man glaubt an die Wissenschaft und unterstützt Maßnahmen, oder man tut es nicht. Dies kann komplexe politische Debatten durchschneiden und eine geradlinigere Ausrichtung erzwingen, was diejenigen, die an die Krise glauben, möglicherweise effektiver mobilisiert.
3. Auf welche Krise wird hier Bezug genommen?
Die Krise ist der Klimawandel, der die langfristige Verschiebung globaler Wetterpattern, den Anstieg des Meeresspiegels und häufigere sowie schwerwiegendere Extremwetterereignisse wie Hurrikane, Waldbrände und Hitzewellen umfasst, die größtenteils durch menschliche Aktivitäten verursacht werden.
4. Wer ist Francesco Grillo?
Francesco Grillo ist ein italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Politikanalyst, der den Einblick lieferte, dass Trumps Ablehnung ironischerweise die politische Landschaft im Hinblick auf Klimamaßnahmen vereinfachen könnte.
Fortgeschrittene, wirkungsorientierte Fragen
5. Ist Wissenschaftsleugnung nicht ein Rückschritt? Wie kann das möglicherweise helfen?
Ja, es ist ein Rückschritt für Wissenschaft und Politik. Die Hilfe liegt nicht in der Leugnung selbst, sondern in der politischen Reaktion, die sie hervorruft. Indem eine extreme Position eingenommen wird, kann die Debatte so stark polarisiert werden, dass sie die Opposition mobilisiert, deren Botschaften vereinfacht und deren Bemühungen als Gegenbewegung beschleunigen kann.
6. Können Sie ein reales Beispiel für diese Vereinfachung in Aktion nennen?
Ja. Als die US-Bundesregierung unter Trump aus dem Pariser Abkommen austrat und Umweltvorschriften zurücknahm, veranlasste dies viele US-Bundesstaaten, Städte und große Unternehmen, eigene "We Are Still In"-Allianzen zu bilden und aggressivere Klimaziele zu setzen, was eine dezentralisierte, aber hochmotivierte Front für Maßnahmen schuf.
7. Was sind die größten Risiken dieser Art von politischer Polarisierung beim Klimawandel?
Das größte Risiko ist der Politikwechsel, bei dem Vorschriften und internationale Verpflichtungen mit jedem Regierungswechsel geschaffen und dann rückgängig gemacht werden. Dies schafft Unsicherheit für Unternehmen, die in grüne Technologien investieren, und verlangsamt den Fortschritt.