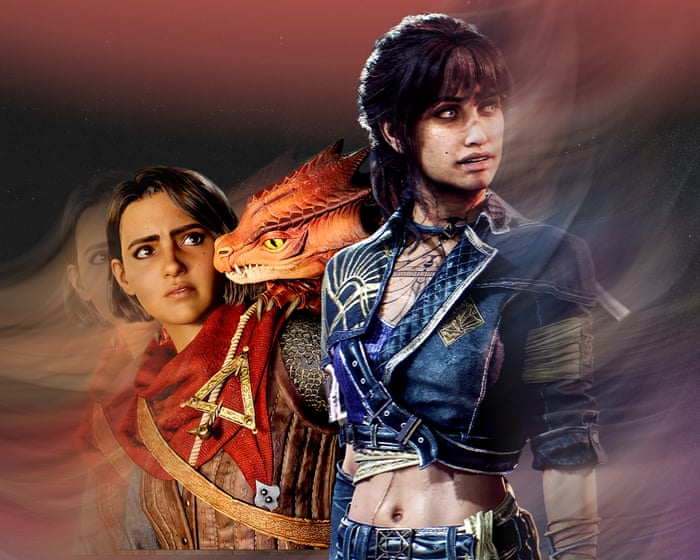Die deutsche Grünen-Partei, Die Grünen, war einst das Vorbild für Umweltbewegungen in ganz Europa. Anfang 2021 führten sie in nationalen Umfragen mit fast 30 % Zustimmung, was Spekulationen über einen möglichen grünen Kanzler auslöste. Nur vier Jahre später steckt die Partei in der Krise – zerstritten, aus der Regierung verdrängt und in Umfragen kaum noch über 10 %, nachdem sie bei der Wahl im Februar 33 Sitze verloren hatte. Da das politische Zentrum Deutschlands bröckelt, müssen die Grünen dringend wieder Anschluss an die breite Wählerschaft finden.
Ihre größte Herausforderung? Führung. Auf ihrem Höhepunkt halfen Annalena Baerbock und Robert Habeck – als pragmatische Figuren, die gut zu Deutschlands konsensorientierter Politik passten – der Partei, zu florieren. Nach der Wahl 2021 wurde Baerbock Außenministerin und Habeck Vizekanzler in Olaf Scholz’ Koalitionsregierung. Doch als diese Regierung scheiterte, verloren die Grünen eine Million Stimmen und fielen auf den vierten Platz. Nun verlassen Schlüsselfiguren die Partei: Habeck plant einen Umzug nach Dänemark, Baerbock übernahm eine UN-Rolle, und die gesamte Führung der Grünen Jugend trat zurück.
Dieser Exodus hätte eine Chance für Erneuerung sein können. Die Grünen wählten neue Co-Vorsitzende – Franziska Brantner (45) und Felix Banaszak (35) – sowie neue Führungskräfte der Grünen Jugend, darunter den Klimaaktivisten Jakob Blasel und die selbsternannte „linksradikale“ Jette Nietzard. Doch statt Einheit offenbarten diese Ernennungen tiefe Gräben. Seit den 1980er Jahren ist die Partei zwischen Pragmatikern (Realos) und Idealisten (Fundis) gespalten. Diese alten Spannungen sind wieder aufgeflammt, nun entlang generationeller Linien.
Parteiführer atmeten erleichtert auf, als Nietzard ankündigte, im Herbst nicht wieder anzutreten. Ihre umstrittenen Positionen – das Tragen von „ACAB“ (anti-Polizei) und „Eat the rich“-Slogans, sogar Überlegungen zu bewaffnetem Widerstand gegen rechtsextreme Koalitionen – schreckten die gemäßigten Wähler ab, die die Grünen brauchen. Während solche Ansichten bei Deutschlands Linksextremen Anklang finden, ist dieser Raum bereits von Die Linke besetzt, die durch eine härtere Linie gegen Rechts an Boden gewonnen hat. Beide Parteien liegen nun bei 10–12 % in Umfragen.
Die neue Grünen-Führung will die Identitätskrise der Partei überwinden und ins Zentrum zurückkehren. Banaszak hat die Partei von der radikalen Linken distanziert und offen seine Meinungsverschiedenheiten mit Nietzard eingeräumt. Mit ihrem Abgang hoffen sie, die Realo-Dominanz wiederherzustellen. Diesen Sommer bereisen die Vorsitzenden Deutschlands polarisierteste Regionen – das industrielle Ruhrgebiet und den ehemaligen Osten –, um wieder Anschluss an Arbeiterwähler zu finden.
Ihre Bemühungen ernteten zunächst Spott, etwa als Banaszak sich im Zug auf den Boden setzte, obwohl er erste Klasse gebucht hatte. Doch wenn die Tour den Grünen hilft, Deutschlands politische Realitäten zu begreifen, könnte sie mehr sein als eine PR-Aktion. In Thüringen, einer AfD-Hochburg im Osten, erfuhr Banaszak vom Teenager-Sohn eines grünen Bürgermeisters, dass die Grünen dort als „radikale Klimaaktivisten“ wahrgenommen werden. Doch wenn die Leute sehen, dass Grüne konkrete Verbesserungen bringen – wie die Wiederbelebung von Dörfern oder die Reparatur von Straßen –, könnte ihr Image sich erholen.
In Duisburg, einer westdeutschen Industriestadt, fragte Brantner, ob die Grünen junge männliche Wähler vergrault hätten, indem sie ihnen keine positive Identität boten. Sie merkte an, dass Debatten über Männlichkeit oft mit dem Label „toxisch“ versehen wurden. Diese Art der Selbstreflexion ist neu und entscheidend. Die AfD will durch Trump-ähnliche Spaltung an die Macht kommen. Wenn die Grünen weiter nach links rücken und das Zentrum aufgeben, das die AfD zerstören will, helfen sie nur der extremen Rechten.
Die AfD kreist wie Geier, doch in Berlin mobilisiert eine neue, junge Linke gegen sie.
Deutschlands politische Landschaft bietet noch Platz für eine gemäßigte Grünen-Partei. Mit der richtigen Balance könnten sie zur führenden Mitte-links-Kraft werden und gemäßigte Politik stärken. Ihre Fähigkeit, mit Konservativen zusammenzuarbeiten, ist eine ihrer Stärken. In Baden-Württemberg regiert Grünen-Chef Winfried Kretschmann seit 2011 mit CDU-Unterstützung – ein Modell, das bundesweit funktionieren könnte. Er ist sogar bei konservativen Wählern beliebt.
Ob es gefällt oder nicht: Deutschland hat eine konservative Mehrheit, die politische Repräsentation sucht. Die CDU hat eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen, sodass sie an die angeschlagene SPD gebunden ist. Eine CDU-Grünen-Koalition könnte das politische Zentrum stärken und die bedrohte Demokratie verteidigen. Sie würde Umweltthemen auch zurück in den Mainstream bringen.
Ob die neuen Grünen-Führer ihre zersplitterte Partei hinter pragmatischem Progressivismus vereinen können, ist ungewiss. Doch sie müssen es versuchen – nicht nur für das Überleben ihrer Partei, sondern für Deutschlands Demokratie.
Katja Hoyer ist eine deutsch-britische Historikerin und Journalistin. Ihr neuestes Buch ist Beyond the Wall: East Germany, 1949-1990.*