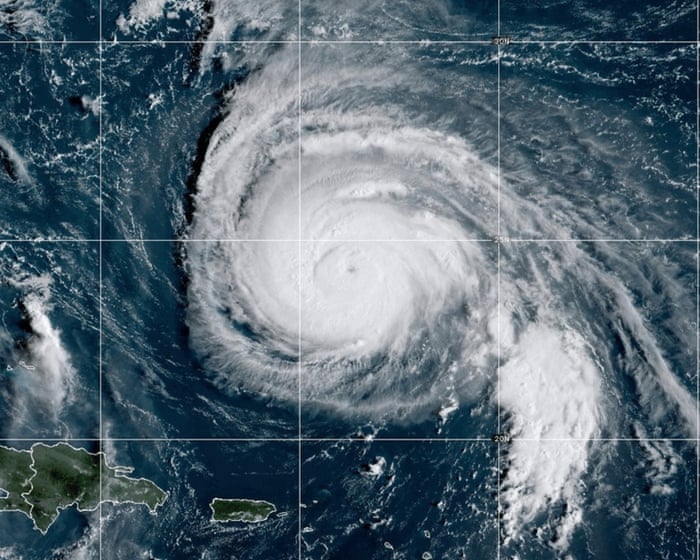Die Pennsylvania Railroad bot im Sommer 1919 einen düsteren Blick auf ein Amerika im Aufruhr. Claude McKay, der als Speisewagenkellner arbeitete, hatte solche Angst, dass er einen versteckten Revolver in seiner knitterfreien weißen Jacke trug. Diese unruhige Zeit, bekannt als der Rote Sommer, sah eine Welle rassistischer Gewalt, die das Land überzog.
In der gesamten westlichen Welt waren Hunderttausende Veteranen des Ersten Weltkriegs nach Hause zurückgekehrt und suchten Arbeit. Unter ihnen waren schwarze Soldaten, die für die Alliierten gekämpft hatten in der Hoffnung, ihr Dienst würde ihnen gleiche Rechte verschaffen. Stattdessen erlebten sie bittere Enttäuschung.
Wettbewerb um Jobs und Arbeitskräfte legte tiefsitzende Vorurteile offen und entfachte weitverbreitete Unruhen und Lynchmorde in den gesamten Vereinigten Staaten. Von April bis November 1919 wurden Hunderte Menschen – meist schwarze Amerikaner – getötet und Tausende weitere verletzt. McKay, ein 28-jähriger jamaikanischer Einwanderer und aufstrebender Dichter, war zutiefst von der Brutalität betroffen. Er erinnerte sich später: „Es war das erste Mal, dass ich so offenem, unnachgiebigem Hass gegenüber meiner Rasse gegenüberstand, und meine Gefühle waren unbeschreiblich. Ich hatte von Vorurteilen in Amerika gehört, aber ich hatte mir nie vorstellen können, dass sie so intensiv bitter sein könnten.“
Diese Erfahrung prägte sein Schreiben zutiefst. Mitten in den Unruhen des Roten Sommers verfasste er das kraftvolle Sonett „If We Must Die“. Das Gedicht, 1919 in der linken Zeitschrift The Liberator veröffentlicht, die von Max und Crystal Eastman gegründet worden war, wurde als „die Marseillaise des amerikanischen Negers“ gefeiert. Seine Schlusszeilen „Like men we'll face the murderous, cowardly pack / Pressed to the wall, dying, but fighting back!“ zementierten McKays Ruf als literarische Stimme. Nachdem es in bedeutenden schwarzen Zeitungen und Magazinen nachgedruckt worden war, wurde er als „ein Dichter seines Volkes“ gefeiert.
Die Veröffentlichung von „If We Must Die“ leitete eine lebenslange Partnerschaft mit den Eastmans ein, die nicht nur seine Arbeit lektorierten, veröffentlichten und bewarben, sondern ihm auch finanzielle Unterstützung gewährten. Allerdings zog das Gedicht unerwünschte Aufmerksamkeit des Justizministeriums auf sich, das afroamerikanischen Radikalismus untersuchte und das Gedicht als aufhetzend einstufte.
Ende des Sommers kündigte McKay seine Stelle bei der Eisenbahn und begann in einer Fabrik in Manhattan zu arbeiten, wo er der revolutionären Gewerkschaft Industrial Workers of the World (IWW) beitrat. Viele glauben, dass Druck des Justizministeriums seine Entscheidung beeinflusste, die USA im September 1919 in Richtung Großbritannien zu verlassen, obwohl McKay später eine geförderte Reise von literarischen Bewunderern und einen lebenslangen Wunsch, seine „wahre kulturelle Heimat“ zu besuchen, als Gründe für seine Abreise angab.
In England stellte McKay fest, dass die Realität nicht seinem idealisierten Bild des „literarischen Englands“ entsprach. Entsetzt musste er erfahren, dass die rassistische Gewalt den Atlantik überquert hatte. Bis zum Herbst 1919 waren in London, Liverpool, Cardiff, Manchester und Hull Unruhen ausgebrochen, die fünf Tote, Dutzende Verletzte und mindestens 250 Verhaftungen zur Folge hatten. Weitere Auseinandersetzungen in den Jahren 1920 und 1921 wurden durch Konkurrenz um Jobs und Wohnraum sowie durch feindselige Haltung weißer Menschen gegenüber interrassischen Beziehungen angeheizt. Ein Polizeibericht aus Cardiff vermerkte: „Es besteht kein Zweifel, dass die Angreifer der weißen Rasse angehörten.“
Laut der Historikerin Jacqueline Jenkinson entsprangen die Unruhen im Vereinigten Königreich 1919 den Nachwirkungen des Krieges: „In einer Zeit der Belastung, in der Xenophobie nach über vier Jahren ständiger deutscher und fremdenfeindlicher Propaganda fast zu einer Lebensweise geworden war, wurden jene, die aufgrund dunkler Haut als ‚fremd‘ angesehen wurden, zu legitimen Zielen für Nachkriegsgroll.“
Internationale Seeleute wurden durch den imperialen Handel mit Kohle und anderen Gütern in die britischen Häfen gezogen. Bis zum späten 19. Jahrhundert schätzt der Autor Stephen Bourne, dass die nicht-weiße Bevölkerung Großbritanniens bei einer Gesamtbevölkerung von 45 Millionen mindestens 10.000 betrug. Die größten Gemeinden befanden sich in Hafenstädten wie Londons Docklands, Cardiff, Hull und Liverpool. Ihre Präsenz wurde durchaus wahrgenommen. In Cardiff führte kurz vor dem Ersten Weltkrieg ein pensionierter Seefahrtskapitän in seiner Zeitung, dem Maritime Review, eine lange Kampagne gegen im Ausland geborene Seeleute. Eine Karikatur zeigte John Bull – das Symbol Englands – wie er an einer Klippe hing, während eine Figur mit wilden Haaren und Ohrringen an seinen Knöcheln klammerte. Bull sagt: „Wenn ich diesen Kerl nicht abstoße, bin ich erledigt.“
Während des Krieges wuchsen diese vielfältigen Gemeinden, als Seehäfen zur Heimat von Afrikanern, Westindern, Indern, Chinesen, Malaysiern und Arabern wurden, die auf britischen Schiffen gedient hatten. Doch nach dem Krieg führte der Wettbewerb um Jobs zu Diskriminierung – Gewerkschaften verboten nicht-weißen Seeleuten die Arbeit auf britischen Handelsschiffen – und in den Häfen brachen Unruhen aus. Diese Ausschreitungen eskalieren zu Angriffen auf Pensionen und Geschäfte, die nicht-weißen Einwohnern gehörten. Die wirtschaftlichen Bedingungen waren hart: Die Kosten für Grundnahrungsmittel und Kleidung verdreifachten sich während des Krieges. Für Arbeitslose wurden nicht-weiße Menschen zu einfachen Sündenböcken.
Einige der schlimmsten Gewalttaten ereigneten sich in Liverpool, wo Menschenmengen auf 10.000 anwuchsen und über 700 nicht-weiße Menschen zwangen, in Bridewell, dem zentralen Gefängnis, Polizeischutz zu suchen. Nach einer Reihe von Kämpfen zwischen Seeleuten verschiedener Nationalitäten berichtete die lokale Zeitung Globe, dass ein junger Schwarzer ins Meer gestoßen wurde und eine Menge weißer Hafenarbeiter „so lange Steine auf ihn warf, bis er zum letzten Mal unterging.“ Das Liverpool Echo fügte hinzu, dass das Opfer Charles Wootton war, ein Angehöriger der Royal Navy. Ein Polizeidetektiv versuchte ihn zu retten, doch als er ein Schiffstau hinunterkletterte, traf ein Stein aus der Menge Wootton am Kopf und er verschwand unter der Wasseroberfläche. Niemand wurde verhaftet.
Ein schwarzer Mann spricht während der Rassenunruhen 1919 zu einer Menge im Bezirk Tiger Bay in Cardiff. Foto: PD
McKay begann zu glauben, dass die Zustände in England genauso schlimm seien wie in den USA. Auf der Suche nach einer Unterkunft in London landete er in einer „scheußlichen kleinen Gassenschlucht in der Nähe des Angel“. Kneipen verweigerten ihm oft den Service und er war regelmäßig verbalen und sogar körperlichen Übergriffen ausgesetzt.
McKay suchte nach einer Literaturszene ähnlich der, die er in Harlem zurückgelassen hatte, und entdeckte schließlich einen Club für nicht-weiße Soldaten in Londons Drury Lane. Dort traf er „ein paar farbige Amerikaner, Ostinder und Ägypter“, die Geschichten über Rassismus in der britischen Armee und auf Londons Straßen während des Waffenstillstands erzählten. Er genoss es, die robusten Boxkämpfe in der Nähe zu besuchen und stellte seinen neuen Freunden amerikanische Publikationen wie die Crisis, den Messenger und die Negro World vor. Hubert Harrison, Redakteur der Negro World und ein Bekannter aus Harlem, bat McKay, eine Serie über das Leben in London zu schreiben. McKay schrieb über den Soldatenclub, erzürnte jedoch die Hausdame, indem er ihre „herablassende weiße mütterliche Haltung gegenüber ihren farbigen Schützlingen“ beschrieb.
Da Drury Lane nun tabu war, suchte McKay nach einem anderen Zufluchtsort. Frank Harris, der irische Redakteur des Pearson’s Magazine, hatte ihm mehrere Empfehlungsschreiben gegeben, darunter eines an George Bernard Shaw. Nach einem denkwürdigen Abend in Shaws Haus in der Adelphi Terrace half Shaw McKay, einen Leserausweis für das British Museum zu erhalten. Andere Briefe führten ihn zum International Socialist Club (ISC) in London, wo er andere linksintellektuelle wie George Lansbury, den Redakteur des Daily Herald, traf. McKay fand den ISC „voller Aufregung mit seinen Dogmatikern und Doktrinären radikaler linker Ideen: Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten, Syndikalisten, Gewerkschaftlern und Befürwortern einer großen Union.“ Zu dieser Zeit traf er zufällig Sylvia Pankhurst. Sie war die Redakteurin der Workers’ Dreadnought, einer wichtigen wöchentlichen Publikation für die radikale progressive Linke mit Sitz in Bow im Londoner East End. Pankhurst hatte die Dreadnought im März 1914 gegründet. Ursprünglich Woman’s Dreadnought genannt, unterstrich der Name ihren Hintergrund als Suffragette. Doch im Juli 1917 verlagerte sie den Fokus der achtseitigen Zeitung und änderte den Titel, um ihn dem mutigen, radikalen Inhalt anzupassen. Im gesamten East End verteilt, erreichte sie wöchentlich 20.000 Leser. Die Dreadnought verband Nachrichten, globale Analysen, persönliche Geschichten aus dem Arbeiterleben – ob Soldaten oder Hafenarbeiter – und eine Prise Poesie. Sie vertrat Arbeiter- und feministische Perspektiven zu einer Zeit, als solche Stimmen selten zu hören waren. „Ich wollte, dass die Zeitung so weit wie möglich aus dem Leben geschrieben ist“, sagte Pankhurst einmal. „Keine trockenen Argumente, sondern ein lebendiges Bild der Realität, das immer von spezifischen menschlichen Erfahrungen zu breiteren Prinzipien übergeht.“
Sylvia Pankhurst war sich McKays bereits bewusst. Sie war eng mit den Eastmans befreundet, den Gründern des Liberator in New York. Im September 1919, einen Monat bevor sie sich trafen, druckte sie mehrere seiner Gedichte – darunter „If We Must Die“ – in der Dreadnought unter der Überschrift „Ein Negerdichter“ nach und merkte an, dass McKay sie geschrieben habe, während er als Speisewagenkellner arbeitete.
McKay beschrieb Pankhurst als „eine kleine, schmucklose Frau, etwa so groß wie Königin Victoria, mit einer Fülle langer, ungebändigter bronzener Haare… Ihre Augen waren feurig, fast fanatisch, doch mit einem scharfen, schlauen Glitzern… In der Arbeiterbewegung forderte sie ständig selbstgefällige und faule Führer heraus… Und wo immer der Imperialismus einheimische Völker unterdrückte, war Pankhursts Zeitung zur Stelle, um darüber zu berichten.“
In einem Leitartikel der Dreadnought, der auf dem Höhepunkt der Sommerunruhen am 7. Juni 1919 unter dem Titel „Neger in der Londoner Hafenregion erstechen“ veröffentlicht wurde, stellte Pankhurst „ein paar Fragen an diejenigen, die Neger gejagt haben“. Sie fragte: „Ist euch nicht klar, dass Kapitalisten, besonders britische Kapitalisten, gewaltsam Länder erobert haben, die von Schwarzen bewohnt werden, und sie zum Profit regieren… Würdet ihr eure Zeit nicht besser damit verbringen, die Bedingungen für euch und eure Arbeitskollegen zu verbessern, anstatt einen Schwarzen zu erstechen?“
Ihre Worte machten einen starken Eindruck auf McKay. In London engagierte er sich in Pankhursts Workers‘ Socialist Federation (WSF), die regelmäßige Treffen und Spendenaktionen abhielt. McKay bemerkte, dass Pankhurst nicht nur über revolutionären Marxismus sprach – sie lebte ihn, indem sie unter und mit East-End-Arbeitern arbeitete und wohnte. Er nannte sie eine „geschickte Agitatorin und Kämpferin“ mit der „Ausstrahlung, Menschen zur Organisation zu ziehen“. Die beiden entdeckten, dass sie viele Überzeugungen teilten. McKay war ein lautstarker Unterstützer der Frauenrechte und des Frauenwahlrechts, ein Pazifist und ein Agnostiker. Trotz ihrer Unterschiede – der junge, gutaussehende Jamaikaner und die erfahrene Suffragette – hielt ihre Partnerschaft an.
Im April 1920 bot Pankhurst McKay eine Vollzeitstelle als Arbeiterexperte der Zeitung an und gewährte ihm Unterkunft und Verpflegung. Er nahm begierig an. Einer seiner ersten Aufträge war, über die angespannte Situation in Londons Häfen zu berichten, wo er Seeleute verschiedener Hintergründe interviewte, um ihre Beschwerden zu verstehen. Er berichtete über Streiks und Gewerkschaftstreffen und war auch damit beauftragt, Artikel aus ausländischen Publikationen zusammenzustellen, insbesondere solche, die die britische Politik kritisierten. Das britische imperialistische Projekt war ein Schwerpunkt für McKay. In seinem ersten Titelaufsatz für die Zeitung argumentierte er, dass nationalistische Bewegungen, besonders unter kolonisierten Völkern in britischen Territorien, diese zum Kommunismus treiben würden. Er schrieb: „Das britische Empire ist das größte Hindernis für den internationalen Sozialismus, und jede seiner unterdrückten Regionen, die Unabhängigkeit erlangt, würde die Sache des Weltkommunismus voranbringen.“
McKay war unglaublich produktiv, veröffentlichte viele Essays, Artikel, Buchrezensionen und einige seiner trotzigsten Gedichte, oft unter falschen Namen. Er hatte in den USA begonnen, Pseudonyme zu verwenden, besorgt, dass seine radikale Poesie seine Jobchancen schädigen könnte. In Großbritannien behielt er diese Praxis bei, zumal Scotland Yard die Aktivitäten der Workers‘ Socialist Federation überwachte.
Durch McKays Beiträge bot die Dreadnought zu einer Zeit, als Mainstream-Medien Menschen of Color oft verteufelten, eine schwarze Perspektive. Nach dem Ersten Weltkrieg verschwanden in London ansässige Zeitungen, die sich an diese Gemeinschaften richteten, wie die African Times and Orient Review, schnell.
Am 6. April 1920 besetzten französische Truppen als Reaktion auf Deutschlands Verstoß gegen den Vertrag von Versailles wichtige Städte am Ostufer des Rheins. Etwa 2 % der 250.000 französischen Truppen im Rheinland stammten aus Westafrika, doch die Anwesenheit schwarzer Soldaten in einer weißen europäischen Nation stieß bei einigen auf Abscheu. Während der Besetzung eröffneten französische marokkanische Soldaten – zusammen mit einem großen senegalesischen Kontingent – das Feuer auf eine deutsche Menge, die gegen ihre Anwesenheit in Frankfurt protestierte, und töteten mehrere Zivilisten. Der Daily Herald war die einzige englische Zeitung, die die Rasse dieser Truppen hervorhob, mit einer Schlagzeile auf der Titelseite am 9. April: „Frankfurt fließt mit Blut: Französische schwarze Truppen beschießen Zivilisten mit Maschinengewehren.“
Am nächsten Tag veröffentlichte der Herald eine Reihe von Titelseitenartikeln des Journalisten E.D. Morel, die den Konflikt in rassistischen Begriffen darstellten. Unter der Überschrift „Die schwarze Geißel in Europa: Sexueller Horror, den Frankreich am Rhein entfesselt“, beschuldigte Morel schwarze Truppen, die er „primitive afrikanische Barbaren“ nannte, die Landschaft zu terrorisieren und Vergewaltigungen zu begehen. Er behauptete auch, dass Syphilis dort weit verbreitet sei, wo sie stationiert waren, und gab ihre „kaum zu bändigende Bestialität“ dafür verantwortlich.
Diese Berichte lösten weltweit Empörung aus, mit Protesten in London und Schweden, die Frankreich aufforderten, seine „wilden“ Soldaten abzuziehen. In den USA wuchs der Zorn so stark, dass Präsident Woodrow Wilson im Juni 1920 eine Untersuchung anordnete. Ein nachfolgender Bericht des Diplomaten E.L. Dresel stellte fest, dass die meisten Geschichten über „schwarzen Schrecken“ am