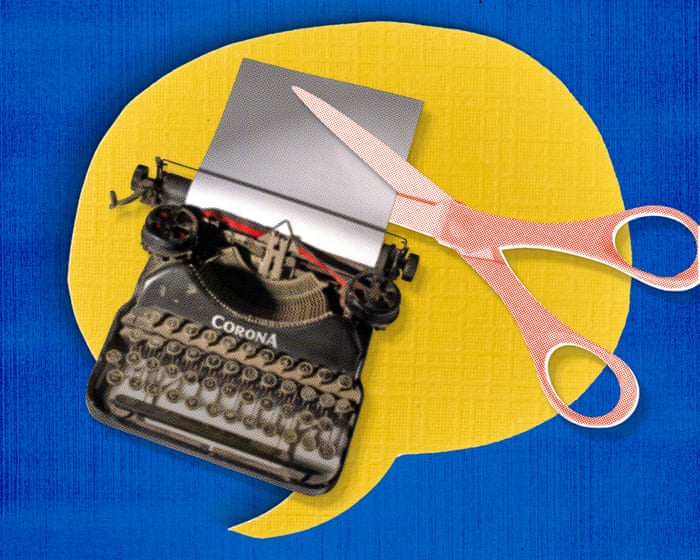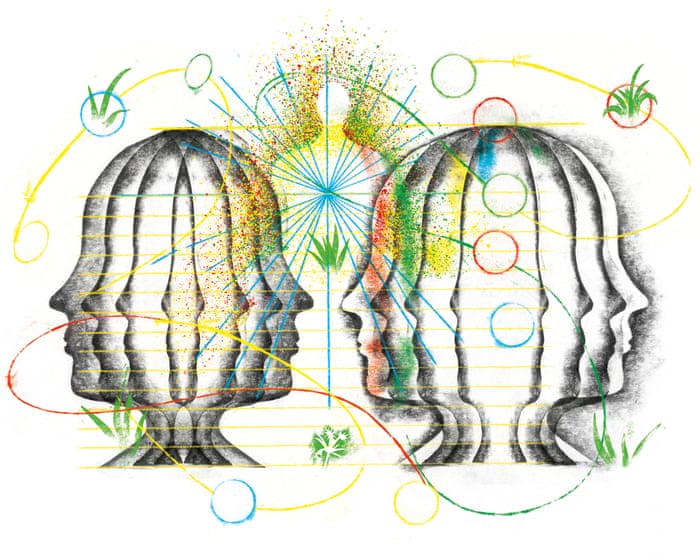Vor der deutschen Küste, in den Brackgewässern, liegt eine Ödnis aus Bomben, Torpedos und Minen aus der Nazi-Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg von Lastkähnen entsorgt und in Vergessenheit geraten, haben sich diese Tausenden von Munitionskörpern im Laufe der Zeit miteinander verheddert und bilden einen rostenden Teppich auf dem flachen, schlammigen Meeresboden der Lübecker Bucht in der westlichen Ostsee.
Jahrzehntelang wurde dieses Nazi-Arsenal ignoriert und übersehen. Inzwischen strömten immer mehr Touristen zu den Sandstränden und ruhigen Gewässern der Region zum Jetski-Fahren, Kitesurfen und in die Vergnügungsparks. Unter der Wasseroberfläche verfielen die Waffen langsam.
Als Wissenschaftler erstmals die Auswirkungen dieser Munition auf das Ökosystem untersuchten, erwarteten einige eine öde, vergiftete Einöde ohne jedes Leben. Andrey Vedenin vom Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt leitete ein Team, das erstmals dokumentierte, welche Lebewesen auf den Unterwasserwaffen überleben können.
Was sie entdeckten, verblüffte sie. Vedenin erinnert sich, wie seine Kollegen vor Überraschung riefen, als das Tauchboot die ersten Bilder übermittelte. "Es war ein großartiger Moment", sagt er.
Tausende Meerestiere hatten sich zwischen der Munition angesiedelt und ein blühendes Ökosystem geschaffen, das dichter besiedelt war als der umliegende Meeresboden. Diese Unterwasser-Metropole demonstrierte die Widerstandsfähigkeit des Lebens. "Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Leben wir an Orten finden, die eigentlich giftig und gefährlich sein sollen", bemerkt Vedenin.
In einem markanten Beispiel hatten sich über 40 Seesterne auf einem einzelnen freiliegenden TNT-Block versammelt. Sie lebten auf Metallgehäusen, Zündertaschen und Transportbehältern nur Zentimeter vom Sprengstoff entfernt. Fische, Krabben, Seeanemonen und Muscheln wurden alle auf den alten Waffen gefunden. "Man könnte es in puncto Artenvielfalt mit einem Korallenriff vergleichen", so Vedenin.
Die Munition trägt ein regeneriertes Ökosystem, in dem viele Arten, darunter der sonst seltene oder rückläufige Ostsee-Dorsch, gedeihen. Laut der im September in der Zeitschrift Communications Earth & Environment veröffentlichten Studie der Forscher lebten durchschnittlich über 40.000 Tiere auf jedem Quadratmeter der Munition, verglichen mit nur 8.000 pro Quadratmeter im Umkreis.
Vedenin findet es ironisch, dass "Dinge, die alles töten sollten, so viel Leben anziehen". Er fügt hinzu: "Man sieht, wie sich die Natur nach einem katastrophalen Ereignis wie dem Zweiten Weltkrieg anpasst und wie das Leben selbst an die gefährlichsten Orte zurückfindet."
Die Ergebnisse in der Lübecker Bucht enthüllen eine überraschende Wahrheit darüber, wie Meerestiere von Menschen hinterlassenen Schutt umfunktionieren. Während "Zersiedelung" normalerweise als schädlich für die Natur gilt, kann die Geschichte unter Wasser anders sein. Harte Oberflächen wie jene von Munition bieten Lebensraum für Korallen, Schwämme, Seepocken und Muscheln sowie Kinderstuben für Fische.
Vor dem Krieg war dieser Teil der Ostsee reich an Felsblöcken und -vorsprüngen, doch fast alle wurden für Bauvorhaben entfernt. Künstliche Strukturen wie Schiffswracks, Windparks, Bohrinseln und Pipelines können als Ersatz dienen und einen Teil des verlorenen Lebensraums ersetzen. Diese Studie legt nahe, dass Munition ähnliche Vorteile bieten könnte und das explosionsartige Leben in der Lübecker Bucht auch anderswo auftreten könnte.
Zwischen 1946 und 1948 wurden 1,6 Millionen Tonnen Waffen vor der deutschen Küste versenkt. Tausende Menschen luden sie auf Lastkähne; einige wurden an ausgewiesenen Stellen abgeladen, andere einfach über Bord geworfen. Dies ist das erste Mal, dass Forscher beobachtet haben, wie sich das Meeresleben angepasst hat.
Der Meeresboden von Nord- und Ostsee ist übersät mit Munition aus beiden Weltkriegen, darunter Geschosse, die einst von deutschen Kriegsschiffen abgefeuert wurden.
Dieses Phänomen beschränkt sich nicht auf Waffen. In den USA haben stillgelegte Öl- und Gasanlagen sich durch das "Rigs-to-Reefs"-Programm in Korallenriffe verwandelt, das das Belassen gereinigter und stabiler Unterwasserstrukturen zum Umweltnutzen fördert. Ähnlich dienen versenkte Schiffe aus dem Ersten Weltkrieg im Potomac River in Maryland nun als Lebensräume für Wildtiere.
Diese Orte gewinnen für die Tierwelt an Bedeutung, da die Ozeane durch Fischerei, Grundschleppnetzfischerei und Ankern zunehmend ausgelaugt werden. Laut Vedenin fungieren versunkene Schiffe und Waffenstandorte effektiv als Schutzzonen – keine offiziellen Nationalparks, aber Gebiete, in denen die meisten menschlichen Aktivitäten verboten sind. Infolgedessen gedeihen dort Arten wie der Ostsee-Dorsch, die sonst selten oder rückläufig sind.
Vedenin weist darauf hin, dass Meere in der Nähe von Militärkonfliktzonen des letzten Jahrhunderts typischerweise mit Munition übersät sind, was Millionen Tonnen Sprengstoff in unseren Ozeanen ausmacht.
Die Dokumentation dieser Munition ist aufgrund von Landesgrenzen, klassifizierten Militärdaten und in historischen Archiven versteckten Aufzeichnungen schwierig. Sie bergen Risiken von Explosionen, Sicherheitsbedrohungen und anhaltenden giftigen Chemikalienlecks.
Seit den 1990er Jahren warnen Experten vor der "Gefahr aus der Tiefe" und der Dringlichkeit, diese Sprengkörper zu entfernen. Der Druck, die Waffen zu räumen, ist auch durch die zunehmende Nutzung des Meeresbodens für andere Zwecke wie Baggerarbeiten oder Offshore-Projekte wie Windparks, Kabel und Pipelines gewachsen.
Während Deutschland und andere Nationen beginnen, diese Relikte zu entfernen, wollen Wissenschaftler die Ökosysteme schützen, die sich um sie entwickelt haben. In der Lübecker Bucht laufen bereits Räumungsarbeiten.
Vedenin schlägt vor, die gefährlichen Metallüberreste der Munition durch sicherere Alternativen wie Betonstrukturen zu ersetzen. Er hofft, dass die Vorgehensweise in Lübeck ein Vorbild für andere Gebiete sein wird, das zeigt, dass selbst die zerstörerischsten Waffen eine Grundlage für neues Leben bieten können.
Beispielsweise sind Panzerketten von US-Gerät, das während der Invasion von Guam 1944 verloren ging, vor dem Asan Beach zur Heimat von Korallen geworden, was zeigt, wie Überreste von Konflikten die Biodiversität fördern können.
Häufig gestellte Fragen
Natürlich, hier ist eine Liste von FAQs darüber, wie entsorgte Unterwassermunition zu Meereslebensräumen wird, in einem klaren und natürlichen Ton verfasst.
Anfänger – Allgemeine Fragen
1. Was sind Unterwasserarsenale?
Es sind alte, entsorgte Militärwaffen wie Bomben, Torpedos und Seeminen, die nach Kriegen oder Übungen oft auf dem Meeresboden zurückgelassen wurden.
2. Wie kann etwas Gefährliches wie eine Bombe zum Lebensraum werden?
Mit der Zeit rosten diese Metallobjekte und zerfallen, wodurch Nischen, Spalten und harte Oberflächen entstehen. Auf dem weiten sandigen oder schlammigen Meeresboden wirkt diese Struktur wie ein künstliches Riff und bietet Lebewesen Versteck, Lebensraum und Nahrung.
3. Ist es nicht gefährlich für Meerestiere, auf Sprengstoff zu leben?
Grundsätzlich ja, wenn die Munition noch scharf und instabil ist. Viele liegen jedoch seit Jahrzehnten unter Wasser und sind inert. Die Hauptgefahr geht von Störungen aus, die eine Explosion verursachen könnten, nicht vom langsamen Austritt von Chemikalien, was ein separates Problem darstellt.
4. Welche Arten von Lebewesen findet man typischerweise an diesen Orten?
Oft findet man eine große Vielfalt an Leben, einschließlich Algen, Seepocken, Seeanemonen, Korallen, Kraken, Hummer und viele Fischarten, die die Strukturen als Unterschlupf nutzen.
5. Werden diese Waffen aus Sicherheitsgründen entfernt?
Manchmal, aber die Entfernung ist oft riskanter als sie liegen zu lassen. Der Prozess kann teuer, technisch anspruchsvoll sein und die Waffe zur Explosion bringen, was dem Ökosystem mehr schadet. Oft werden sie überwacht und ungestört gelassen.
Fortgeschrittene – Detaillierte Fragen
6. Was ist das Hauptumweltrisiko dieser versenkten Munition?
Das größte Risiko ist die mögliche Freisetzung schädlicher Chemikalien, wenn die Metallhüllen korrodieren. Dies kann Sprengstoffe wie TNT und chemische Kampfstoffe umfassen, die Wasser und Sediment vergiften und Meereslebewesen beeinträchtigen können.
7. Können Sie ein bekanntes Beispiel für ein Unterwasserarsenal nennen, das zum Lebensraum geworden ist?
Ja, ein gutes Beispiel ist das Bikini-Atoll im Pazifik. Nach Atomtests wurden zahlreiche Kriegsschiffe versenkt, die heute blühende Korallenriffe sind, die vor Meeresleben trotz der Restradioaktivität strotzen.
8. Wie verhält sich dieser Prozess im Vergleich zu absichtlich versenkten künstlichen Riffen wie alten Schiffen?
Der ökologische Prozess ist identisch – beide bieten ein hartes Substrat, das Leben besiedeln kann. Der Schlüssel