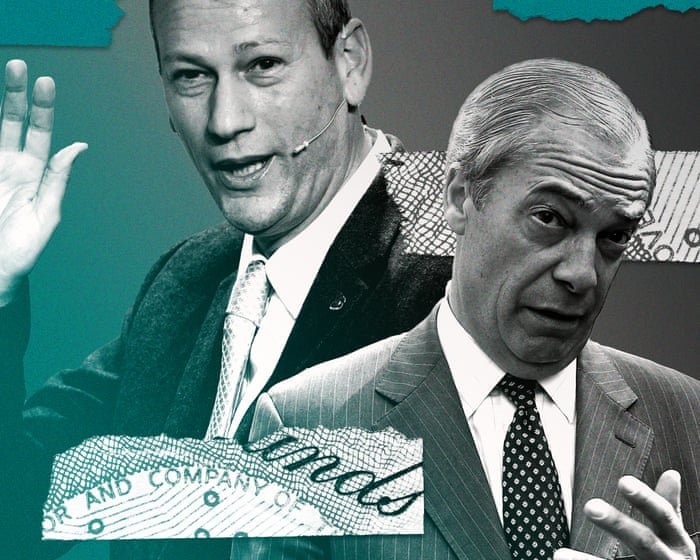Wie die meisten Spanier heute wurde ich nach Francos Tod vor 50 Jahren geboren. Selbst für die Generation meiner Eltern wirkt die Diktatur, die von 1939 bis zum 20. November 1975 dauerte, heute wie ein ferner Albtraum. Als ich aufwuchs, handelten die Geschichten, die ich hörte, meist vom Übergang zur Demokratie nach Franco – einer Zeit der Hoffnung und Energie, in der junge Menschen alles von Grund auf neu aufbauten.
Meine Mutter, die mit mir schwanger war, als sie 1977 bei den ersten freien Wahlen ihre Stimme abgab, erinnert sich an diese Zeit als die glücklichste ihres Lebens. Internationale Medienberichte aus jenem Jahr sprachen von "verbreitetem Optimismus" in einer bald "gesunden, modernen und lebendigen Nation".
Im Oktober 1977 schrieb der Philosoph und ehemalige politische Gefangene Julián Marías: "Die Franco-Jahre scheinen unglaublich weit entfernt; fast alles, was einst unmöglich schien, ist bereits geschehen." Dies war weniger als zwei Jahre nach Francos Tod, und Spanien hatte noch kein vollständiges demokratisches System oder eine Verfassung.
Wie viele europäische Länder damals sah sich Spanien auch politischer Gewalt und Wirtschaftskrisen gegenüber. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist die Angst und Verwirrung während des Putschversuchs im Februar 1981, als ich Nachrichtenmeldungen im Radio hörte.
Dennoch ist es rückblickend bemerkenswert, wie sich Spanien von einem armen, isolierten Agrarland in eine dynamische Demokratie verwandelte, die innerhalb weniger Jahre die meisten europäischen Länder an Offenheit und sozialen Rechten übertraf. In 50 Jahren ist das BIP inflationsbereinigt um mehr als das 15-Fache gewachsen, die Exporte haben sich fast verachtfacht, und die Beschäftigung hat sich nahezu verdoppelt, während die Bevölkerung von 35 auf fast 50 Millionen Menschen anwuchs. Die Homo-Ehe wurde 2005 legalisiert, etwa ein Jahrzehnt vor den USA, Großbritannien oder Deutschland.
Der Übergang zur Demokratie verlief angesichts seines raschen Ablaufs bemerkenswert reibungslos, teilweise dank europäischer Gelder und Unterstützung. Doch beim Versuch, Gerechtigkeit und Versöhnung in Einklang zu bringen, neigte sich Spanien stark zur Versöhnung. Nur wenige Verbrechen der Diktatur wurden strafrechtlich verfolgt, und mit der Zeit wandelte sich die Amnestie in Amnesie.
Ehemalige Franco-Regime-Beamte wurden in politische Parteien aufgenommen – meist in die Vorgängerpartei der heutigen Volkspartei. Es gab keine öffentliche Abrechnung mit den Millionären oder Großunternehmen, die das Regime und damit jahrzehntelange Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen unterstützt hatten. Spanien behielt sogar König Juan Carlos als Staatsoberhaupt, den Franco zu seinem Nachfolger bestimmt hatte – in einer Beziehung, die der in Ungnade gefallene Ex-König in einer neuen Memoiren als fast "väterlich-söhnlich" beschreibt. Juan Carlos' eigene Rolle beim demokratischen Übergang und beim Putschversuch bleibt umstritten.
Heute wird die Franco-Ära in Schulen gelehrt, aber oft hastig am Ende eines vollen Geschichtslehrplans im letzten Jahr der Oberstufe abgehandelt. Sie war weitgehend aus der öffentlichen Debatte verschwunden, bis die Mitte-links-Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero 2007 das erste Historische Gedächtnisgesetz verabschiedete, das mit dem Abriss von Franco-Denkmälern und -Symbolen begann, in Nationalarchive investierte und die Suche nach Überresten der im Bürgerkrieg der 1930er Jahre Getöteten unterstützte.
Pedro Sánchez ist weiter gegangen, hat neue Gesetze eingeführt und bestehende durchgesetzt. Der symbolträchtigste Schritt war 2019 die Umbettung von Francos Überresten aus dem Tal der Gefallenen (jetzt umbenannt in Valle de Cuelgamuros) – einem von politischen Gefangenen erbauten Mausoleum bei Madrid, wo er jahrzehntelang geehrt worden war, begraben unter seinen Opfern. Ein neues Projekt wird den Ort umgestalten, mit Ausstellungen, Artefakten und Aufnahmen, die erstmals seine dunkle Geschichte erklären.
Das ist wichtig, denn die Geschichte des Franquismus offen und öffentlich zu erzählen, ist... Spanien hat viel zu lange etwas gefehlt. Wichtiger als das Entfernen von Symbolen ist ihre Erklärung. Das Land hat nicht einmal ein nationales Geschichtsmuseum und hinkt Deutschland, Italien, Portugal und sogar jüngeren Demokratien wie Slowenien bei der Aufarbeitung und Darstellung seiner Vergangenheit hinterher.
Politiker der Rechten wehren sich gegen viele dieser Bemühungen und machen das historische Gedächtnis zu einer weiteren parteiischen Frage. Selbst Spaniens Übergang zur Demokratie, einst idealisiert und lange Quelle des Stolzes, wird nun infrage gestellt, da der politische Konsens zerbrochen ist.
In Spanien tun wir uns schwer mit der Vergangenheitsbewältigung, wie andere dunkle Kapitel der jüngeren Geschichte zeigen, besonders im Zusammenhang mit Terrorismus. Doch wenn man sich der Vergangenheit nicht vollständig stellt, kann sie zurückkehren und einen heimsuchen.
Meine Mutter ist oft gleichermaßen überrascht und bestürzt, wenn sie sehr junge Menschen – auch wenn es eine kleine Minderheit ist – den faschistischen Gruß sehen oder Francos Hymne singen hört oder Führer der rechtsextremen Partei Vox die Verbrechen der Diktatur herunterspielen hört. In letzter Zeit spricht sie mehr über ihre eigenen Erinnerungen: wie sie während Universitätsprotesten gegen Francos letzte Hinrichtungen vor der berittenen Polizei, bekannt als "los grises" wegen ihrer grauen Uniformen, weglief; wie sie flüsternd davon erzählte, dass ihr Cousin nach Frankreich ging, um politische Aktivisten zu treffen; und wie sie sich fragte, was mit ihrem lang verschollenen Onkel geschah, der ein Opfer der Repression gewesen sein könnte.
"Das Leben war grau", sagt sie heute. Wie viele, die die Diktatur durchlebten, ist sie schockiert, dass jemand im heutigen Spanien diese problematische Vergangenheit gutheißen könnte. Diese Menschen sollten es besser wissen, aber sie hätten auch besser unterrichtet werden sollen.
Es besteht keine Gefahr, dass der Franquismus nach Spanien zurückkehrt, aber das Vergessen der Geschichte kann dazu führen, dass wir die demokratischen Freiheiten, die ständige Wachsamkeit und Schutz erfordern, als selbstverständlich hinnehmen.
María Ramírez ist Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin von elDiario.es, einer Nachrichtenplattform in Spanien.
Häufig gestellte Fragen
Natürlich, hier ist eine Liste von FAQs zur Aufarbeitung des Schweigens über die Franco-Ära in Spanien, die klar, direkt und zugänglich sein soll.
Anfängerfragen
1. Wer war Francisco Franco?
Francisco Franco war ein Militärgeneral, der Spanien von Ende des Spanischen Bürgerkriegs 1939 bis zu seinem Tod 1975 als Diktator regierte.
2. Was bedeutet das kollektive Schweigen über seine Ära?
Es bezieht sich auf die weit verbreitete, oft unausgesprochene Übereinkunft in der spanischen Gesellschaft nach seinem Tod, die Schmerzen, Unterdrückung und Spaltungen seines Regimes nicht zu diskutieren, um einen friedlichen Übergang zur Demokratie zu gewährleisten.
3. Warum ist es wichtig, jetzt darüber zu sprechen?
Die Auseinandersetzung mit dieser schmerzhaften Geschichte ist entscheidend für die Heilung, die Ehrung der Opfer, das Verständnis des modernen Spaniens und die Gewährleistung, dass eine solche Diktatur nie wieder geschieht. Schweigen kann Trauma und ungelöste Probleme an neue Generationen weitergeben.
4. Wie war das Leben für normale Menschen unter Franco?
Das Leben war geprägt von politischer Repression, Zensur, eingeschränkten Freiheiten und für viele von Armut. Das öffentliche Leben wurde stark von konservativ-katholischen Werten und einer einzigen staatlich kontrollierten Partei beeinflusst.
5. Was ist der Pakt des Vergessens?
Es war eine informelle politische Übereinkunft während des Übergangs zur Demokratie in den späten 1970er Jahren, Verbrechen aus dem Bürgerkrieg und der Franco-Ära nicht strafrechtlich zu verfolgen, sondern sich stattdessen auf den Aufbau einer neuen, vereinten Zukunft zu konzentrieren.
Fortgeschrittene Fragen
6. Wie trug das Bildungssystem zu diesem Schweigen bei?
Jahrzehntelang übersprangen Schulbücher den Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur weitgehend im Detail und präsentierten eine vereinfachte oder neutrale Version der Ereignisse. Dies verhinderte, dass junge Menschen die ganze Geschichte lernten.
7. Was sind konkrete Beispiele für die Repression des Regimes?
Beispiele sind Massenhinrichtungen, Zwangsarbeitslager, die Verfolgung politischer Gegner, die Unterdrückung regionaler Sprachen und Kulturen sowie Gesetze, die die Rechte von Frauen stark einschränkten.
8. Was ist das Gesetz zum historischen Gedächtnis?
Das 2007 verabschiedete Gesetz zielte darauf ab, die Rechte der Opfer des Bürgerkriegs und der Diktatur formell anzuerkennen und zu erweitern. Es unterstützt die Exhumierung von Massengräbern und die Entfernung franquistischer Symbole aus öffentlichen Räumen.
9. Warum gibt es heute noch politische Spaltung über dieses Thema?
Einige politische Parteien und