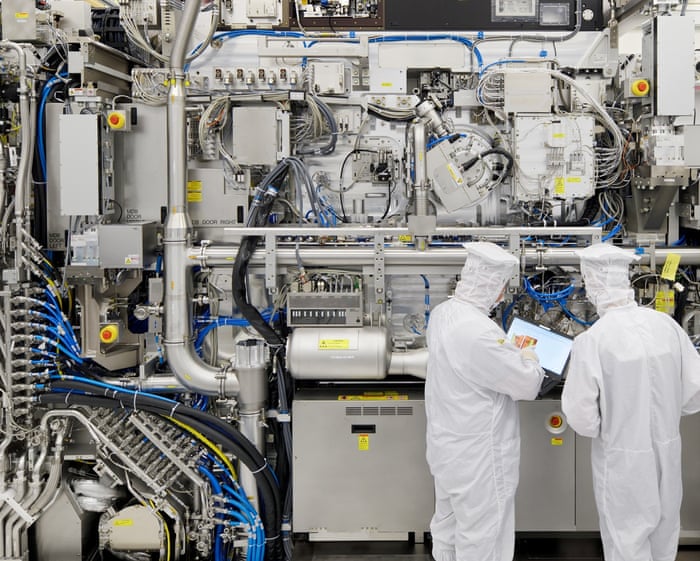Deutschlands Sicht auf seine Autoindustrie wirkt etwas veraltet. Wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Auto als Deutschlands Schicksal und das Herz seiner Wirtschaft beschreibt und warnt, dass "ohne das Auto der Zusammenbruch bevorsteht", scheint er sich auf ein Verbrennerfahrzeug zu beziehen, das mit fossilen Brennstoffen fährt. Diese nostalgische Treue zu den schweren, umweltverschmutzenden Industrien des 20. Jahrhunderts kollidiert nun mit den drängenden Realitäten der Klimakrise.
Anfang dieses Monats trafen sich europäische Autokonzerne mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Berlaymont-Gebäude in Brüssel. Deutsche Hersteller hatten zwei zentrale Forderungen: das geplante EU-Verbot neuer CO₂-emittierender Verbrenner ab 2035 zu kippen und die jährlichen Absatzquoten für Elektrofahrzeuge bis dahin zu lockern.
Das Ergebnis des Treffens war nicht sofort klar. Einige Berichte deuteten an, die EU könnte Hybridfahrzeuge nach 2035 weiter zulassen. Eine Entscheidung wird bis Dezember erwartet, und es scheint wahrscheinlich, dass das Verbot abgeschwächt wird. Ein Sprecher erwähnte, die Kommission werde "alle Beiträge sorgfältig prüfen", einschließlich möglicher "Nachbesserungen" wie der Zulassung einiger Plug-in-Hybride.
Der Widerstand der Autoindustrie gegen die 2035-Frist ist Teil eines breiteren Widerstands gegen EU-Umweltpolitiken. Druck von Industrie- und Agrarsektoren hatte bereits zum Rückzug eines Pestizidreduktionsgesetzes, zu Verzögerungen bei Entwaldungsregeln und zur Streichung Umweltberichtspflichten für Risikobranchen geführt.
Letztlich sollte die EU der deutschen Autoindustrie nicht nachgeben. Ein Kurswechsel wäre nicht nur schädlich für Klimaziele und Umwelt, sondern für alle Beteiligten, einschließlich der Hersteller selbst. Der deutsche Automobilsektor macht etwa 5 % des BIP aus, kämpft aber bereits mit globalen Wettbewerbern und hinkt bei der Elektrifizierung fast ein Jahrzehnt hinterher. Eine Verzögerung der Umstellung auf emissionsfreies Fahren wird sie nur weniger wettbewerbsfähig machen.
Vor dem Brüsseler Treffen lobbyierten die Autobauer massiv. Ola Källenius, Kopf des Verbands der Automobilindustrie und Mercedes-Benz, schrieb einen fordernden Offenen Brief, in dem er argumentierte, die CO₂-Ziele für 2030 und 2035 seien "einfach nicht mehr machbar" und forderte deren vollständige Streichung.
Das eigentliche Problem ist, dass die deutsche Autoindustrie nur langsam handelt, während Rivalen wie Tesla und chinesische Firmen mit staatlichen Subventionen Expertise und Ruf aufgebaut haben, die Deutschland noch fehlt.
Einige deutsche Medien unterstützten die Autoindustrie mit Interviews und wohlwollenden Kommentaren. Doch diese Nachsicht wird sich langfristig weder für die Industrie noch für das Land lohnen.
Die deutsche Autoindustrie beschäftigt rund 770.000 Menschen, ohne Zulieferer. Ein zentrales Argument ihrer Lobbyarbeit ist, dass strenge Vorschriften Jobs kosten würden. Doch die Hersteller streichen bereits Stellen: 50.000 Jobs gingen letztes Jahr verloren, mehr als in jedem anderen deutschen Sektor. Die weitere Produktion von Verbrennern wird Jobverluste weder verhindern noch nennenswert verzögern. Der Grund ist klar: Es sind gewinnorientierte Unternehmen, keine öffentlichen Dienste. Die Familien mit großen Anteilen an VW und BMW – die Piëchs, Porsches, Klattens und Quandts – zählen zu Deutschlands reichsten Personen.
Eine Greenpeace-Protestaktion in Berlin unterstrich Deutschlands Drängen auf Ausnahmen vom EU-weiten Verbot. Die Europäische Union will den Verkauf neuer Verbrenner bis 2035 verbieten. Foto: Maja Hitij/Getty Images
Deutschlands Autoindustrie hat einen riesigen Stellenwert in Wirtschaft und nationaler Identität, was diesen Unternehmen besonderen Einfluss bei der Durchsetzung ihrer Forderungen verleiht. Nur Tage vor dem Brüsseler Treffen trat Friedrich Merz auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in München auf. An einem Mikrofon in einer hellen Halle beschwor er in Branchenjargon: "Wir wollen uns nicht auf eine Lösung festlegen, wir wollen einen Wettbewerb der besten Ideen und Technologien." Doch Merz' Argumentation würde die notwendige Entwicklung der deutschen Autoindustrie behindern.
"Die Zukunft ist elektrisch", erklärte von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union zwei Tage vor dem Autogipfel. Das ist kein leeres Schlagwort. Im August 2025 stiegen die Neuzulassungen für E-Autos in Deutschland um 46 % im Vorjahresvergleich. Die Branche ist selbst gespalten. Noch am Tag von Merz' Rede appellierten 150 E-Auto-Firmen in einem Offenen Brief an die Kommissionspräsidentin, am 2035-Verbot "festzuhalten". Audichef Gernot Döllner nannte die neue Debatte über den Ausstieg "kontraproduktiv".
Autokonzerne setzen sich oft durch. Im Mai lockerte die EU-Kommission Regeln für klimaneutrale Fahrzeugflotten und gewährte Herstellern zwei Extra-Jahre zur Zielerreichung. Diese Entscheidung bewahrte viele Firmen vor hohen Strafen – außer Mercedes-Benz, das voraussichtlich den Emissionszielen verfehlt. Mercedes wird von Källenius geführt, der diese Ziele vehement ablehnt.
Der Diesel-Skandal 2015 – bei dem Konzerne wie VW Abgastests manipulierten – zeigte, wie weit die Industrie geht. Selbst als sie die Bundesregierung täuschte und den Ruf "Made in Germany" beschädigte, blieb sie weitgehend folgenlos. Tatsächlich erhalten Hersteller jährlich Millionen an Forschungsförderung für Projekte wie selbstfahrende Autos; allein BMW meldete 2024 mindestens 36 Mio. € an Förderung von Deutschland und der EU.
Das Festhalten am 2035-Plan und der Übergang zu sauberer Technologie sind entscheidend, besonders da der Umweltschutz insgesamt ins Stocken gerät. Bürger und Unternehmen brauchen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Stabilität und Planbarkeit. Dies kann nur durch die Anerkennung der Dringlichkeit von Modernisierung erreicht werden – nicht durch das Abschaffen von Regulierungen und das Zurückdrehen von Fortschritt.
Tania Roettger ist Journalistin in Berlin.
Dieser Artikel wurde am 29. September 2025 geändert, um einen möglicherweise irreführenden Verweis auf sauberere "Kraftstoffe" im letzten Absatz zu entfernen.
Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs zum Thema "Deutsche Identität wird nicht durch Autos definiert – Brüssel muss der mächtigen Autoindustrie die Stirn bieten" aus der Perspektive von Tania Roettger.
Einsteigerfragen
1 Was ist die Hauptthese dieses Meinungsartikels?
Die Hauptthese ist, dass Deutschlands Nationalstolz und Wirtschaftsfokus nicht so stark an seine Autoindustrie gebunden sein sollten. Der Artikel fordert die EU-Regierung in Brüssel auf, stärkere Regulierungen zu schaffen, die die Autoindustrie in eine nachhaltigere Zukunft drängen, selbst wenn dies schwierig ist.
2 Warum sagt die Autorin, dass deutsche Identität nicht durch Autos definiert wird?
Die Autorin ist der Ansicht, dass Deutschland eine reiche Kultur, Geschichte und Werte jenseits des Automobilbaus hat. Eine zu starke Abhängigkeit vom Auto für die nationale Identität hält das Land davon ab, notwendige Umwelt- und Technologieveränderungen zu embraceieren.
3 Was bedeutet "Brüssel muss der Autoindustrie die Stirn bieten"?
Es bedeutet, dass das Regierungsorgan der Europäischen Union mutig sein und strenge Umweltgesetze gegenüber den Autoherstellern durchsetzen muss, anstatt der Lobbymacht der Industrie nachzugeben.
4 Warum gilt die Autoindustrie als mächtig?
Die Autoindustrie ist ein großer Arbeitgeber und ein wesentlicher Teil der deutschen Wirtschaft. Dadurch hat sie erheblichen Einfluss auf Politiker und kann lobbyieren, um Umweltvorschriften, die ihren traditionellen Geschäftsmodellen schaden könnten, zu verzögern oder abzuschwächen.
Fortgeschrittene Fragen
5 Was sind die spezifischen Probleme mit der derzeitigen Macht der Autoindustrie?
Die Probleme umfassen die Verlangsamung des Übergangs zu Elektrofahrzeugen, den Widerstand gegen ambitionierte Klimaziele und die Gefahr, dass Deutschland in grünen Technologien zurückfällt, was seiner Wirtschaft langfristig schaden könnte.
6 Welche Art von Regulierungen könnte Brüssel auferlegen?
Beispiele sind das Verbot des Verkaufs neuer Benzin- und Dieselautos zu einem bestimmten Stichtag, die Festsetzung sehr strenger CO₂-Emissionsgrenzwerte und starke Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel und Ladeinfrastruktur für E-Autos anstatt auto-zentrierter Politik.
7 Wie könnte eine geringere Fokussierung auf Autos Deutschland nutzen?
Es könnte Deutschland helfen, ein Vorreiter in grüner Technologie zu werden, die Luftqualität in Städten zu verbessern, seine Klimaziele zu erreichen und anderen innovativen Sektoren zu ermöglichen, zu florieren, was eine diversifiziertere und zukunftssichere Wirtschaft schaffen würde.
8 Ist das nicht ein Risiko für deutsche Arbeitsplätze?
Während es ein Risiko für Arbeitsplätze in der traditionellen Fertigung gibt, ist das Argument, dass der Widerstand gegen Veränderungen ein größeres langfristiges Risiko darstellt.