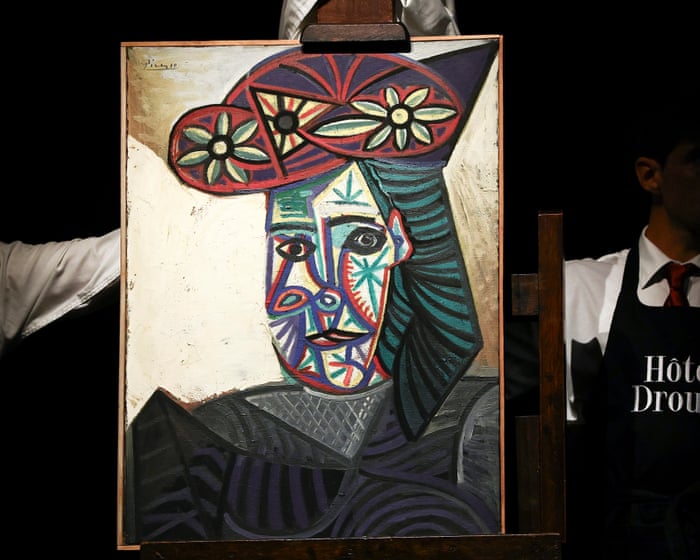Margaret Atwood braucht länger als üblich für ihren Lebensmitteleinkauf in einem Supermarkt in Toronto. Nicht weil die Autorin von Die Geschichte der Magd diesen Monat 86 wird, sondern weil sie jedes Produkt genau auf seine Herkunft prüft, bevor es in den Wagen kommt: Kalifornische Satsumas sind tabu, kanadische Kartoffeln erwünscht. Obwohl Atwood leidenschaftliche Umweltaktivistin ist, liegt ihr Fokus heute weniger auf Luftkilometern als auf dem Boykott von Waren aus den USA. "Ellenbogen hoch!", ruft sie und schlägt in der Gemüseabteilung eine kämpferische Pose ein.
Zurück in ihrer Küche ruft sie ein YouTube-Sketch auf, in dem Kanadas Premierminister Mark Carney und Komiker Mike Myers in Hockeyausrüstung die Bedeutung von "Ellenbogen hoch" erklären – eine Geste, die zum Symbol kanadischen Widerstands wird. "Oh, sie sind wütend. Rasend", sagt sie über die Reaktionen auf Gerüchte, Präsident Trump wolle Kanada zum 51. Bundesstaat machen. "Wir haben keine große Armee. Sie könnten uns überfallen. Aber ich glaube nicht, dass sie es tun. Haben sie eine Ahnung, wie es wäre, ein feindseliges Kanada zu besetzen? Das wäre kein Witz." Zunächst müsste Trump sich mit Atwood selbst anlegen.
"Ich kriege Hasspost, wie alle", bemerkt sie. "So viele seltsame sexuelle Angebote wie früher sind es nicht mehr, aber einige erhalte ich noch."
Ihre Verleger sorgen sich offenbar, sie könnte sterben, bevor ihr neues Buch erscheint. Während sie das sagt, trägt sie ein großes Tablett die Treppe hinunter in ihren Garten – eine üppige Spätsommeroase mit Ahorn, Linden und Silberbirken. Auf dem Tablett stehen zwei Kaffeekannen (eine entkoffeiniert), ein Teller Kekse und eine Dose Muffins. Ihre Verleger versuchen, sie vor Überanstrengung zu bewahren, aber das ist ein verlorenes Kampf. Erst in der Woche vor meinem Besuch schrieb Atwood eine Kurzgeschichte als Antwort auf einen geplanten Bann "sexuell expliziter" Bücher in Alberta und machte damit Schlagzeilen. Der Vorschlag wurde später zurückgezogen. "Die Albertaner sind eigenwillige Leute", stellt sie fest.
Kürzlich bekam sie einen Herzschrittmacher (daher der entkoffeinierte Kaffee) und nimmt Medikamente, die ihre Haut unter Sonneneinstrahlung blau färben. Sie erzählt, wie ihr 88-jähriger Bruder Harold letzten Winter mit einer Kettensäge einen umgestürzten Baum vom Dach entfernte. Ihre Mutter fegte noch mit über 80 Laub vom Dach. Ich erwähne, ich hoffe, sie steige nicht selbst aufs Dach, und werfe einen Blick auf die Türme. "Nur die flachen Stellen", antwortet sie prompt.
Das Buch, auf das sie anspielt, ist ihre Memoiren Book of Lives, ein Wälzer von 624 Seiten mit schockrosa Schnitt, der zu ihrem Outfit auf dem Cover passt. Seit 1961 hat Atwood etwa jährlich ein Buch veröffentlicht, darunter beliebte Romane wie Katzenauge, Die Räuberbraut, Alias Grace, Der blinde Mörder, die MaddAddam-Trilogie und inzwischen klassische Werke wie Die Geschichte der Magd samt Fortsetzung Die Zeuginnen. Sie arbeitete in allen Genres – Lyrik, Essays, Graphic Novels, sogar Libretti – nur nicht in Autobiografien, da sie stets betonte, kein Interesse am Schreiben über sich selbst zu haben.
"Ich bin eine altmodische Romanautorin. Alles in meinen Romanen kam aus der Beobachtung der Welt um mich herum", sagt sie. "Ich glaube nicht, dass ich viel Innenleben habe." Zwei beeindruckende Wasserspiele im Garten übertönen fast ihr markantes Murmeln. Ihre Sprache ist durchweg ironisch. "Ich fühlte mich so ausgeschlossen während des Zeitalters der Neurosen, als jeder zum Therapeuten gehen sollte. Ich war einmal in Therapie. Der Therapeut langweilte sich mit mir. Ich hatte nichts Interessantes zu sagen."
Sie willigte schließlich ein, das neue Buch unter der Bedingung zu schreiben, es würde keine Autobiografie, sondern "eine Art Memoiren", wie der Untertitel verrät. "Memoiren sind das, woran man sich erinnert", erklärt sie. "Und was man hauptsächlich erinnert, sind Katastrophen und dumme Dinge." "Eide und dumme Dinge."
In ihrem schnoddrig-nüchternen Stil durchschreitet das Buch die Jahrzehnte, streift die Weltwirtschaftskrise, den Zweiten Weltkrieg, McCarthy-Ära, JFKs Ermordung, 9/11, Irakkrieg, Trumpismus und Pandemie. Doch dies ist nicht ihr Blick auf globale Ereignisse oder ihre Herzensthemen – Frauenrechte, Umwelt, Meinungsfreiheit und Literatur. Diese behandelte sie in ihrer Essay-Sammlung 2022 "Burning Questions", einem weiteren Wälzer, zu dem "Book of Lives" als persönliche Ergänzung dient. Hier teilt sie die Entstehungsgeschichten ihrer Romane, begleicht Schulden und rechnet ab: die College-Jungs, die ihr Getränk spickten, der Schriftsteller, der sie als männermordenden Oktopus darstellte ("Ich weiß, wer du bist oder warst, männliche Person"), und der Globe-Journalist, der ihre Küche als düster kritisierte, unter anderem. "Meistens Tote", bemerkt sie nun. "Aber bei den Lebenden ist Wahrheit eine absolute Verteidigung."
Machte das Schreiben ebenso viel Spaß wie das Lesen? "Teilweise war es lustig", sagt sie. "Aber die Teile, in denen Menschen sterben, waren nicht lustig."
Die Memoiren spannen sich von ihrer Kindheit in kanadischer Wildnis bis zum Tod ihres langjährigen Partners, des Schriftstellers Graeme Gibson, 2019, was dem Buch einen romanhaften Bogen verleiht. Gibson starb, während Atwood in Großbritannien "Die Zeuginnen" promotete, und sie setzte die Tour fort. Ihre Beziehung ist die zentrale Liebesgeschichte des Buches, sein Tod die große Tragödie. "Buhu", murmelt sie leise. Ihre jüngsten Kurzgeschichten, Gedichte und besonders die späteren Kapitel der Memoiren sind herzzerreißend in ihrer Darstellung von Verlust, aber sie zeigt ihre Trauer nicht öffentlich.
Das Paar kaufte ihr Haus 1985, heute fast von Bäumen verdeckt. Es war früher ein Kult-Haus, eines von vieren in dieser typisch kanadischen Straße. Die Wände waren mit orangefarbenem Shaggy-Teppich bedeckt, "damit man die Schreie nicht hörte", scherzt sie düster. Heute schmücken Gemälde die Wände, darunter ein großes Porträt Gibsons von einem befreundeten Künstler, Atwood-bezogene Verlagsandenken und Bücher, sortiert in Bereiche wie Krieg, Hexen und kanadische Geschichte. Wenn es etwas Kult-ähnliches gibt, dann die vielen Fan-Geschenke: eine gestrickte Atwood-Figur in Magd-Robe, die das Gästebad bewacht, und eine winzige handgefertigte Bibliothek all ihrer Romane, so klein, dass man eine Pinzette braucht, um sie zu handhaben. Nicht alles Feedback ist positiv. "Ich kriege Hasspost, wie alle", sagt sie. "So viele seltsame sexuelle Angebote wie früher sind es nicht mehr, aber einige erhalte ich noch."
Der Kult um Atwood, gesehen als Seherin und Heilige des 21. Jahrhunderts, wächst stetig. 2019 war sie die erste Autorin auf dem Time-Cover seit Toni Morrison vor zwei Jahrzehnten. Ihr Name taucht alljährlich in der Nobelpreis-Saison auf, obwohl ihre Popularität ihr schaden könnte.
"Wenn die USA eine vollständige Totalität wären, würden wir 'Die Zeuginnen' überhaupt nicht verfilmen. Wir wären im Gefängnis, im Exil oder tot."
Nachdem sie ein Verlagswesen erlebt hat, das von Nachkriegs-Autoren wie Roth, Updike und Bellow dominiert wurde, gefolgt von Briten wie Amis, McEwan und Rushdie, ist es eine gewisse Genugtuung, dass eine zierliche Autorin aus Toronto – einer Stadt, die bei ihrem Start kaum auf der literarischen Landkarte stand – solch dauerhaften Einfluss erreicht hat. "Ich vermute, das ärgert viele Leute", sagt sie sarkastisch. Doch sie spielt ihren Status als eine der berühmtesten Autorinnen der Welt herunter. "Erstens lebe ich noch", erinnert sie mich, "was mich zur ältesten lebenden Was-auch-immer meiner Generation macht. Zweitens machen Kanadier nicht 'am berühmtesten'."
Falls sie "zum Schreien berühmt" ist, wie sie in den Memoiren schreibt, führt sie das auf "einen Zufall der Geschichte" zurück. "Es liegt an der Kombination der Fernsehserie mit tatsächlichen politischen Ereignissen", erklärt sie in Bezug auf die Hulu-Adaption von 2017. Die TV-Adaption ihres Klassikers von 1985, Die Geschichte der Magd, katapultierte sie auf die Weltbühne. Die Dreharbeiten begannen im Sommer 2016 und dauerten bis November. "Die Wahl geschah. Trump gewann", sagt sie. "Alle Beteiligten wachten am nächsten Morgen auf und dachten: 'Wir sind in einer anderen Show!' Nicht weil die Show sich änderte – das tat sie nicht. Die Drehbücher blieben gleich. Der Rahmen änderte sich. Statt 'Oh, niedlich, Fantasie' dachten die Leute: 'Oh Gott, jetzt kommt's.'"
Zu einer Zeit, als Abtreibung in einigen Staaten verboten wurde und Einreisende in die USA ihre Telefone auf anti-Trump-Ansichten überprüfen lassen mussten, wirkte ihre Vision eines zukünftigen Amerikas als totalitäre Theokratie in Die Geschichte der Magd erschreckend treffend. Die roten Magd-Gewänder wurden zum globalen Symbol weiblichen Protests, und Phrasen aus dem Roman erschienen auf Plakaten und T-Shirts. "Make Margaret Atwood Fiction Again" wurde ein Schlachtruf.
Fast ein Jahrzehnt nach Serienstart wurden in Toronto gerade die Dreharbeiten zur ersten Staffel von Die Zeuginnen abgeschlossen, in der die Autorin einen weiteren Cameo-Auftritt hat. In ihrem ersten Auftritt war sie kurz als eine der Tanten zu sehen, die Elisabeth Moss heftig ohrfeigt. Mehr zur neuen Serie darf sie nicht verraten. Natürlich kehrt Ann Dowd als Tante Lydia zurück.
"Die USA sind keine Totalität – noch nicht", sagt sie. "Obwohl sie sich in Richtung einer Machtkonzentration bewegen. Wenn es eine vollständige Totalität wäre, würden wir 'Die Zeuginnen' überhaupt nicht verfilmen. Wir wären im Gefängnis, im Exil oder tot."
1985, als Die Geschichte der Magd erschien, wäre der Sturm auf das Kapitol unvorstellbar gewesen. "Die Mauer stand noch, der Kalte Krieg lief. Amerika war ein Leuchtturm des Lichts, der Freiheit, der Demokratie, was auch immer", sagt sie. "Die Mauer fiel 1989. Die Leute dachten, der Weltkonflikt sei vorbei. Wir gehen einfach shoppen und alles wird gut. Der Kapitalismus hatte gewonnen. Aber wenn man eine Weltordnung so destabilisiert, kommen Leute, um das Vakuum zu füllen."
Sie pausiert, um eine Wespe, die auf ihrem Gebäck landete, wegfliegen zu lassen. "Es ist diese Jahreszeit. Sie haben ihren Fortpflanzungszyklus beendet und haben Zeit übrig", sagt sie, bevor sie abbeißt. "Napoleon Bonaparte, 'Ich bin die Revolution.' Stalin, dasselbe. Trump, 'Amerika, c'est moi! Je suis America!'"
Sie tut den Staaten im Moment leid. "Sie verlieren ihren Weltführer-Status, und China wird übernehmen, wenn sie so weitermachen", sagt sie. "Die Leute sagen: 'Buh, Amerikaner!' Es sind nicht die Amerikaner. Mindestens die Hälfte von ihnen ist überhaupt nicht einverstanden mit dem, was passiert."
In einem der Essays in Burning Questions erinnert sich Atwood an Ratschläge, wie man einem Krokodil entkommt: Zickzack laufen. Es könnte ein Gespräch mit der Autorin beschreiben, das alarmierend über Themen und Jahrhunderte huscht: von Brexit ("Ein Fehler. Rate mal!") zurück 8000 Jahre zu Doggerland (als Großbritannien physisch mit Europa verbunden war), von der Französischen Revolution zu Zombies. Man muss auf die Zähne und den Schwanz achten. Wie sie in den Memoiren zugibt, hat sie den Ruf, "Interviewer auszuweiden". Falls sie gemäßigter geworden ist, dann weil Journalisten nicht mehr fragen, warum sie so miserable Romane schreibt oder ob sie etwas mit ihren Haaren machen sollte. Man weiß immer noch, wenn man eine dumme Frage stellt. "Und warum ist das so, Lisa?" wird sie in einer nörgelnden, leicht unheimlichen Stimme fragen.
Margaret Eleanor Atwood wurde am 18. November 1939 geboren. Dieses historisch ominöse Datum, zweieinhalb Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, prägte ihre Weltsicht; die Vorstellung, dass Macht sich schnell, verheerend und überall verschieben kann, durchdringt fast alles, was sie geschrieben hat.
Ihr Vater Carl war Entomologe, ihre Mutter Margaret Lehrerin vor der Heirat. Atwoods frühe Jahre verbrachte sie in einer Reihe von Hütten in den Wäldern Ontarios und Québecs, wo sie und ihr Bruder Harold mit Schlangen und Kröten spielten. Ihr Spitzname war Peggy.
"Du hast keine Angst", bemerkte ein Freund später. Diese Unerschrockenheit, die sie später im Umgang mit verschiedenen Schlangen und Kröten anwandte, sticht in ihren Memoiren hervor. "Nicht ganz", reflektiert sie nun. "Ich bin vorsichtig bei Bären und Gewittern, besonders Blitzen." Harold hatte eine Beinahe-Begegnung mit einem Blitzschlag. "Im Norden sind das die echten Ängste – Ertrinken folgt dicht auf Platz drei."
Als sie neun war, zog die Familie nach Toronto, nachdem ihr Vater eine Stelle an der Universität antrat. Ihre Schwester Ruth wurde geboren, und sie ging erstmals auf eine richtige Schule. In aufgetragenen Kittelkleidern wurde sie von den komplexen und hinterhältigen Machtspielen unter Neun- und Zehnjährigen Mädchen überrascht, wie sie in ihren Memoiren beschreibt. Dort traf sie Sandra Sanders, die vier Jahrzehnte später die fiktive Tyrannin Cordelia in ihrem Roman Katzenauge inspirierte, oft als Mädchenversion von Herr der Fliegen bezeichnet. Aus dieser Erfahrung lernte sie, nie wieder Tyrannen zu fürchten.
Die junge Peggy war auf dem Weg, wie ihr Vater eine Biologie-Karriere einzuschlagen. Doch an einem Freitag, als sie 16 war, ging sie über den Schulfootballplatz, da poppte ein vierzeiliges Gedicht in ihren Kopf. Dieser Moment besiegelte es – sie war Dichterin. Sie bewahrt noch einen Knopf von dem Kleid, das sie an dem Tag trug, und lebt nach dem Motto: "Wirf nie etwas weg, was nützlich sein könnte."
Sie erhielt ein Stipendium für Harvard, wo später jedes Gebäude in Die Geschichte der Magd Einzug fand, inklusive der Harvard-Mauer, an der exekutierte Leichen zur Schau gestellt wurden – ein Detail, das das College nicht zu schätzen wusste. Ihr erster Job in einer Marktforschungsfirma schaffte es auch in ihren Debütroman Die essbare Frau von 1969. Alles war potenzielles Material.
Freunde zu finden war nie ein Problem; sie "tauchten einfach auf wie Pilze nach dem Regen". Sie erinnert sich an ihre erste Teenager-Romanze – "natürlich hatte er ein Auto" – den Sehr Netten Freund aus ihren frühen Zwanzigern (der noch lebt), eine flüchtige Begegnung mit einem Dichter in einem Edmonton-Park und einen produktiven kanadischen Sachbuchautor, den sie "Der Unheilschwangerer Geliebte" nennt, der sich fälschlich als der ernsthafte Schriftsteller in der Beziehung sah. Er lebt auch noch