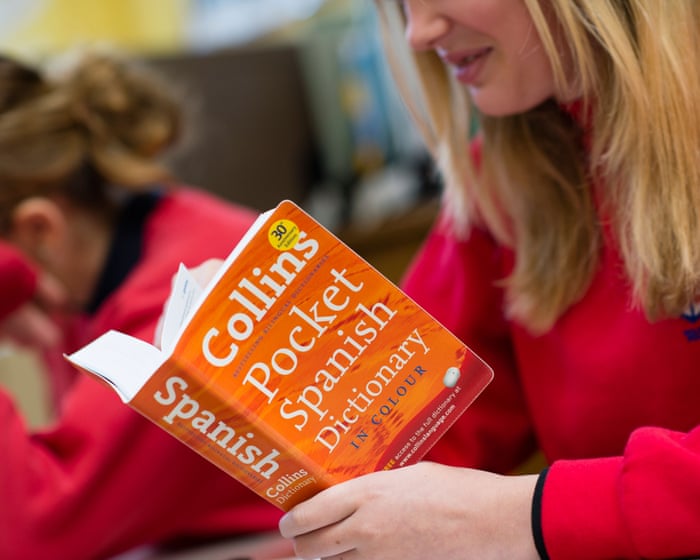Im Sport werden schwarze Athleten oft als mythische Figuren dargestellt – begnadet mit übernatürlicher Geschwindigkeit, außergewöhnlicher Kraft und einer fast magisch anmutenden Genetik. Doch im Alltag kann ein Schwarzer Mensch, der in der Öffentlichkeit läuft, auf Misstrauen, Angst oder Wut stoßen. Die Choreografin Joana Tischkaus neues Werk "Runnin’", das vergangene Woche im renommierten Berliner HAU-Theater uraufgeführt wurde, erforscht diese Spannung und legt sie schonungslos für das Publikum offen.
Die Stückentfaltet sich durch alltägliche Handlungen: Vier Performer bewegen sich in Kreisen über eine leere Bühne. Es bringt die "pedestrian movement" des postmodernen Tanzes – Gehen, Stehen, Sitzen, Bewegungen, die als neutral und fast unsichtbar gelten – in Konflikt mit dem Schwarzen Körper. Das Werk scheint zu fragen: Kann es jemals neutral sein, wenn eine racialisierte Person sich einfach nur bewegt oder atmet in unseren gemeinsamen Straßen?
Das Publikum war gefangen. Wir hatten das Glück, eine Tanzaufführung zu erleben, die zu einem subtilen Metaphor wurde, einem verspielten Spiegelbild dessen, was sich derzeit in der Berliner Kulturszene abspielt. Fragen nach Teilhabe und unbewussten Vorurteilen bezüglich Race und Geschlecht scheinen nicht länger zentral im öffentlichen Diskurs – nicht weil sie gelöst wurden, sondern weil sie leise an den Rand gedrängt wurden, zugunsten einer hohlen Neutralität und einer Rückkehr zum Status quo.
Einige Jahre lang schien es, als würden Deutschlands Kultureinrichtungen einen Wandel durchlaufen. Im Gefolge von Black Lives Matter und #MeToo schossen Podiumsdiskussionen zu strukturellem Rassismus, Geschlechterquoten und Verpflichtungen zur Programmdiversität überall aus dem Boden. Berlin, stets stolz auf sein progressives Image, eilte dazu, das ultimative Vorbild für Diversität zu werden. Und eine Zeit lang war es das auch. Doch nun hat sich die Stimmung dramatisch verschoben.
Überall in der Stadt scheint die Begeisterung für "Diversität" nachgelassen zu haben. Die Energie und Ressourcen, die einst antirassistischer und inklusiver Arbeit gewidmet waren, sind verblasst, und Diversitätsprogramme werden bei Sparmaßnahmen oft als erstes gestrichen. Auf einer Berliner Kunstkonferenz Anfang dieses Jahres bemerkte Tischkau: "Als Schwarze deutsche, nicht-behinderte, cisgeschlechtliche Frau ist es mir gelungen, durch das extrem kurze Fenster der sogenannten 'diversitätssensiblen Öffnung' zu schlüpfen. Ein Fenster, das sich nun vollständig schließt… Das ist keine Teilhabe. Das ist undemokratisch… Meine Biografie sollte keine Ausnahme, sondern die Regel sein."
Dieses sich schließende Fenster ist keine rein Berliner Geschichte – es ist eine globale. In den USA ist der Backlash lauter und radikaler. Unter Donald Trumps Präsidentschaft wurde Critical Race Theory zur Bedrohung erklärt, und Diversitätstrainings in Bundesbehörden wurden verboten. Universitäten und Schulbezirke werden angegriffen, weil sie Geschichten lehren, die systemischen Rassismus anerkennen. Die Botschaft ist klar: Diversität ist gefährlich.
Dieselbe Rhetorik schwappt über den Atlantik. In Deutschland hat die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) Diversität und Geschlechterpolitik als "ideologische Umerziehung" gebrandmarkt. Sie attackiert Kultureinrichtungen, die marginalisierten Stimmen eine Plattform bieten, und stigmatisiert sie als anti-deutsch und extremistisch. Und zunehmend finden diese Ansichten Gehör.
Doch es sind nicht nur der Wahlerfolg der extremen Rechten oder extreme Budgetkürzungen, die diesen regressiven Kulturwandel vorantreiben. Der Backlash war von Anfang an vorhanden, und wie ich in verschiedenen vertraulichen Gesprächen über die Jahre bedauerlicherweise feststellen musste, kommt er oft von innen. Er kommt von vielen der Menschen, mit denen wir täglich zusammenarbeiten – von denen, die sich als progressiv, sogar links bezeichnen und behaupten, ein Werk allein nach seiner "Qualität" zu beurteilen, im Glauben, gegenüber der Identität des Künstlers völlig neutral zu sein.
Staatlich finanzierte Diversitätsprogramme sahen auf dem Papier gut aus, waren in der Praxis aber immer schwer umzusetzen. Viele, die mit diesen Initiativen gearbeitet haben, sahen sich mit Widerstand und Skepsis konfrontiert, was zeigte, dass das Bekenntnis zur Diversität oft bestenfalls oberflächlich war.
Jeder, der in den letzten Jahren in deutschen Kultureinrichtungen gearbeitet hat, kann vom Kampf berichten, Kollegen davon zu überzeugen, dass weiße, heteronormative oder eurozentrische Perspektiven in der Kunst nicht per se überlegen sind. Es ist, als ignorierten wir die Rolle von Hintergrund und Wissen dabei, welche Kunstwerke wir wertschätzen und welche wir abtun. Um unseren Blickwinkel zu erweitern, müssen wir zunächst erkennen, welche Gemeinschaften und Themen in Kulturräumen fehlen, und dann aktiv daran arbeiten, sie durch gezielte Einladungen, Ausschreibungen und Förderungen einzubeziehen.
Doch begrenzte Ressourcen in der Kunst führen oft zu Konkurrenz, die in die Verteidigung eingefahrener Privilegien abgleiten kann. Initiativen, die sich mit Marginalisierung befassen, werden schnell als "woke" abgetan. Künstler of Color sehen sich gezwungen, ihre Errungenschaften zu verteidigen, die oft Quoten statt Talent und harter Arbeit zugeschrieben werden. Diese Dynamiken spielen sich meist hinter verschlossenen Türen in vertraulichen Gremien ab. Aber wenn Diversitätsdebatten öffentlich werden, werden sie schnell von der politischen Rechten instrumentalisiert.
Nehmen wir den 2023 vom Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) verliehenen Internationalen Literaturpreis an den senegalesischen Autor Mohamed Mbougar Sarr. Zwei Jurymitglieder kritisierten den Auswahlprozess später öffentlich und behaupteten, Identität und Rasse hätten den literarischen Wert überschattet. Sie behaupteten nicht, Sarr habe den Preis nicht verdient – was angesichts seines gefeierten Romans Das diskreteste Gedächtnis der Menschen, der weltweit Anerkennung gefunden hat, absurd gewesen wäre. Stattdessen behaupteten sie, weiße Jurystimmen seien zum Schweigen gebracht und weiße Kandidaten benachteiligt worden. Das HKW, bekannt für seine dekoloniale Haltung, wies diese Vorwürfe entschieden zurück. Dennoch erwies sich die Stellungnahme als nützlich für die rechtsextreme AfD, die sie im Parlament zitierte, um die öffentliche Förderung für die "pro-migrations" Programme des HKW und die Eignung seiner Direktorin in Frage zu stellen.
Die Bedrohung hier ist nicht nur politisch – sie ist kulturell. Wenn Institutionen Diversitätsbemühungen vorsorglich aufgeben, wenn Geldgeber "kontroverse" Themen meiden, wenn Künstlern gesagt wird, ihre Arbeit sei "zu spezifisch", verlieren wir mehr als Repräsentation. Wir opfern Wahrheit und Komplexität. Kunst sollte frei sein, die Welt so zu reflektieren, wie sie ist, nicht so, wie die Mächtigen sie sich wünschen.
Der Anti-Diversitäts-Backlash ist keine bloße Ermüdung – es ist eine bewusste Strategie. Wie alle reaktionären Bewegungen gibt sie vor, eine Rückkehr zur "Neutralität" zu sein. Doch diese Neutralität war immer ein Mythos, wie Werke wie Tischkaus Runnin’ eindrücklich evozieren – manchmal ohne es direkt aussprechen zu müssen. Wir spüren es. Und das ist es, was Kunst außergewöhnlich macht.
Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs basierend auf Fatma Aydemirs Argumentation über Deutschlands Widerstand gegen Diversität.
Einsteigerfragen
1. Was ist die Hauptaussage, die Fatma Aydemir macht?
Sie argumentiert, dass Deutschlands Widerwillen, Diversität zu umarmen, nicht auf einfache Erschöpfung oder Überforderung zurückzuführen ist. Stattdessen ist es eine bewusste Strategie, die oft als neutral oder unparteiisch dargestellt wird.
2. Was bedeutet "als Unparteilichkeit getarnt" in diesem Zusammenhang?
Es bedeutet, dass der Widerstand als fair, objektiv oder farbenblind gerahmt wird. Zum Beispiel könnte jemand sagen "Ich sehe keine Hautfarben", was neutral klingt, aber tatsächlich die realen Erfahrungen und systemischen Nachteile ignoriert, mit denen People of Color konfrontiert sind.
3. Können Sie ein einfaches Beispiel für diesen kalkulierten Ansatz geben?
Ein häufiges Beispiel ist die Personalauswahl. Ein Unternehmen besteht vielleicht darauf, nur die qualifizierteste Person unabhängig vom Hintergrund einzustellen. Das klingt fair, aber wenn ihre Vorstellung von qualifiziert sich ausschließlich auf traditionelle deutsche Bildung und Netzwerke stützt, schließt dies systematisch talentierte Menschen mit diversen Hintergründen aus.
4. Warum ist das ein Problem, wenn es als fair dargestellt wird?
Weil diese Art von Fairness oft den Status quo aufrechterhält und bestehende Ungleichheiten ignoriert. Sie tut so, als ob alle vom gleichen Startpunkt beginnen, was nicht wahr ist. Echte Fairness erfordert ein aktives Erkennen und Ausgleichen dieser Ungleichgewichte.
Fortgeschrittene & Praktische Fragen
5. Wie unterscheidet sich dieser kalkulierte Widerstand von offenem Rassismus?
Offener Rassismus ist oft laut, offensichtlich und absichtlich. Dieser kalkulierte Widerstand ist subtiler und strukturell. Er benutzt die Sprache der Neutralität und Ordnung, um ähnliche ausschließende Ergebnisse zu erzielen, ohne offen voreingenommen zu wirken.
6. In welchen Bereichen der deutschen Gesellschaft ist dies am sichtbarsten?
Dieser Ansatz ist oft zu sehen in:
- Dem Bildungssystem: Ein Widerstreben, Lehrpläne zu dekolonisieren oder Deutschlands Kolonialgeschichte aufzuarbeiten.
- Der Arbeitswelt: Ein Mangel an Vielfalt in Führungspositionen, oft mit einem Mangel an qualifizierten Kandidaten erklärt.
- Bürokratie & Staatsbürgerschaft: Komplexe, unflexible Systeme, die die überproportional benachteiligen, die kein generationenübergreifendes Wissen über deren Funktionsweise haben.
- Medien & Kultur: Eine Tendenz, Geschichten über Minderheiten zu erzählen, anstatt sie von Minderheiten erzählen zu lassen.
7. Was sind die praktischen Konsequenzen dieses Ansatzes für eine diverse Gesellschaft?
Er führt zu einer gläsernen Decke für Minderheiten.